 Wat ik me gisteren afvroeg en waar ik naar ging zoeken bij Epictetus, vond ik vandaag bij Marcus Aurelius, in de Meditaties. 24. ‘Als je welgemoed en tevreden wilt leven, onderneem dan weinig,’ zegt de wijsgeer Democritus. Nog beter kan men zeggen, ‘Doe alleen wat nodig is; ofwel, doe wat de rede van een rechtgeaard burger noodzakelijk acht en alleen wanneer die rede erom vraagt.’ Want het stemt de geest tevreden, te kunnen zeggen: ‘Mijn daden zijn gering in tal, maar wat ik doe is welgedaan.’ Het merendeel van wat wij doen en zeggen is immers onnodig en indien ge er iets van zoudt nalaten, zoudt ge meer tijd en een grotere gemoedsrust hebben. Daarom moet ge u afvragen bij alles wat ge doet, ‘Is dit niet een van de dingen die onnodig zijn?’ Maar niet alleen ons handelen, ook ons denken moet bevrijd worden van wat onnodig is. Immers dan volgen er ook geen handelingen die niet ter zake doen.’
Wat ik me gisteren afvroeg en waar ik naar ging zoeken bij Epictetus, vond ik vandaag bij Marcus Aurelius, in de Meditaties. 24. ‘Als je welgemoed en tevreden wilt leven, onderneem dan weinig,’ zegt de wijsgeer Democritus. Nog beter kan men zeggen, ‘Doe alleen wat nodig is; ofwel, doe wat de rede van een rechtgeaard burger noodzakelijk acht en alleen wanneer die rede erom vraagt.’ Want het stemt de geest tevreden, te kunnen zeggen: ‘Mijn daden zijn gering in tal, maar wat ik doe is welgedaan.’ Het merendeel van wat wij doen en zeggen is immers onnodig en indien ge er iets van zoudt nalaten, zoudt ge meer tijd en een grotere gemoedsrust hebben. Daarom moet ge u afvragen bij alles wat ge doet, ‘Is dit niet een van de dingen die onnodig zijn?’ Maar niet alleen ons handelen, ook ons denken moet bevrijd worden van wat onnodig is. Immers dan volgen er ook geen handelingen die niet ter zake doen.’
Doe geen onnodige dingen, doe weinig. Sommige Zenmeesters spreken van ‘Niets doen’. En daarmee ben ik dan weer helemaal terug bij het begin: Lao Tzu en zo. ‘Several chapters of the most important Taoist scripture, the Tao Te Ching, attributed to Laozi, allude to Wu Wei as "diminishing doing" or "diminishing will" as the key aspect of the sage's success. Taoist philosophy recognizes that the universe already works harmoniously according to its own ways; as man exerts his will against the world he disrupts the harmony that already exists. This is not to say that man should not exert will. Rather, it is how he acts in relation to the natural processes already extant that is critical.
Related translation from the Tao Te Ching by Priya Hemenway:
WU WEI
The Sage is occupied with the unspoken
and acts without effort.
Teaching without verbosity,
producing without possessing,
creating without regard to result,
claiming nothing,
the Sage has nothing to lose.
Wu Wei has also been translated as "creative quietude," or the art of letting-be. This does not mean a dulling of the mind; rather, it is an activity undertaken to perceive the Tao within all things and to conform oneself to its "way." Overigens niet alleen bij de Tao, ook bij Zen-meesters kom je dit fenomeen tegen.
Marcus Aurelius (121 - 180) was de geadopteerde zoon van keizer Pius en regeerde tot zijn dood in 180 n. Chr. zelf bijna twintig jaar als keizer. Hij schreef één boek, de Meditaties of Aan zichzelf, volgens critici geschreven te midden van de oorlog tegen de Parthen, toen hij zijn tijd beter had kunnen besteden aan het leiden van het leger. Als ‘bekeerde' stoïcijn had hij veel belangstelling voor de sociale problemen van de armen, slaven en gevangenen. Desondanks zette hij als keizer de vervolging van de groeiende christelijke bevolking voort, ongetwijfeld omdat hij de christenen als een bedreiging zag voor de Romeinse godsdienst en manier van leven, die gebaseerd was op verovering, polytheïsme en de vergoddelijking van gestorven keizers. Hij stierf tijdens een epidemie op het moment dat hij een campagne voorbereidde om het rijk naar het noorden uit te breiden.
Het belang van de Meditaties ligt in de praktische en aforistische stoïcijnse boodschap. Het boek bestaat uit een losjes samenhangende reeks gedachten over de stoïcijnse filosofie, maar is vooral ook een voorbeeld van een levende ethiek, van een leer die dichter bij religie dan filosofische speculatie staat. Het volgende voorbeeld is karakteristiek voor Marcus Aurelius: `Het geluk in je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten: wees dus op je hoede en zorg dat je geen ideeën hebt die niet passen bij deugd en een redelijke aard'.
Net als Seneca voor hem geloofde Marcus Aurelius dat een goddelijke voorzienigheid de mens rede had gegeven en dat hij de mogelijkheid bezat om een te zijn met het rationele doel van het universum. De stoïcijnse filosofie gaat in de eerste plaats over het leven in overeenstemming met de eigen natuur en de universele natuur, die misschien het beste kan worden begrepen in de betekenis die er door de taoïstische filosofen van het oosten aan wordt gegeven.
Eenvoudig leven en tevredenheid met het eigen lot gaan hand in hand met stoïcisme, maar er bestaat altijd het gevaar dat dit tot quiëtisme leidt. Het stoïcisme is als middel tot sociale controle de ideale ‘religie', hoe meer mensen accepteren dat de dingen goed zijn zoals ze zijn, hoe minder problemen ze voor de keizer zullen veroorzaken. Al is het onwaarschijnlijk dat Marcus Aurelius uit politieke overwegingen het stoïcisme aanhing - de Meditaties lijken oprecht - is het een factor in zijn filosofie die niet over het hoofd mag worden gezien.
De grondgedachte achter de stoïcijnse nadruk op het leven ‘in overeenstemming met de natuur' komt voort uit een bepaalde biologische visie. Volgens de stoïcijnen streven alle ‘bezielde wezens' (waartoe ze alles rekenden wat we nu `bewust leven' zouden noemen) naar zelfbehoud. Zelfbehoud doet een wezen zoeken naar dat wat in overeenstemming is met zijn natuur en passend voor zijn eigen wezen. De mens is begiftigd met rede en zoekt daarom niet alleen voedsel, warmte en beschutting, maar ook de dingen die goed zijn voor zijn intellect. Door de rede kunnen we met grotere trefzekerheid dat kiezen wat in overeenstemming is met onze ware natuur dan we met alleen een dierlijk instinct zouden kunnen.
In deze stoïcijnse opvatting staat het goede en passende voor het menselijke leven centraal. Voor veel denkers zal dat goede en passende gezondheid en rijkdom zijn, maar de stoïcijnen zeggen dat het ultieme goede te allen tijd goed moet zijn. Het is denkbaar dat rijkdom soms nadelig is voor iemand en zelfs gezondheid kan schadelijk zijn, bijvoorbeeld als ik mijn kracht gebruik om kwaad te doen. De stoïcijnen komen daarom tot de conclusie dat alleen deugd altijd het goede is. Deugd zelf is opgebouwd uit de gebruikelijke lijst van Grieks-Romeinse voortreffelijkheden: wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid.
Marcus Aurelius (leerling van Epictetus) werd in 121 in Rome geboren als Marcus Annius Verus en was een neef van Faustina de Oudere. Na het vroegtijdig overlijden van zijn vader werd hij door zijn grootvader (ook M. Annius Verus) grootgebracht. Keizer Hadrianus leerde hem vroeg kennen en was onder de indruk van de jongeman.
Toen hij 15 was, arrangeerde Hadrianus een verloving tussen Marcus en de dochter van zijn adoptiefzoon en toekomstige opvolger, Aelius. Aelius stierf echter voortijdig en de plannen moesten worden gewijzigd. Hadrianus bepaalde in 138, korte tijd voor zijn dood, dat Marcus geadopteerd moest worden door Hadrianus' nieuwe opvolger, Antoninus Pius. Lucius Verus, de zoon van Aelius, moest ook geadopteerd worden.
Een jaar later, in 139 verwierf hij de titel Caesar, werd zijn verloving met de dochter van Aelius ontbonden en een verloving gearrangeerd met Faustina de Jongere, de dochter van zijn adoptiefvader. Het huwelijk vond plaats in 145. Zij kregen 13 kinderen waarvan meer dan de helft gedurende de kinderjaren stierf. Van hun zoons overleefde slechts één, Commodus, zijn kinderjaren. Tijdens zijn jeugd en ook later gedurende zijn keizerschap, dat meer dan 20 jaar duurde, besteedde Marcus Aurelius veel tijd aan de filosofiestudie. Hij was een aanhanger van de Stoïcijnse leer van Epictetus. Marcus werd opgeleid in filosofie door Apollonius van Chalchedon en in retorica door Fronto. Correspondentie tussen leerling en leermeester Fronto is overgeleverd en geeft een beeld van Marcus' opleiding.
Wat is nou eigenlijk echt werkelijk? Dat, wat verbonden is met handelen.
Vrijdag 31 augustus 2007 – Marcus Aurelius: het nodige
Donderdag 30 augustus – Epictetus en Jaspers: 'Alleen het nodige'
 Je moet je niet bezighouden met onnodige dingen in je leven, zegt Epictetus in zijn Encheiridion, het ‘Handboekje voor het morele leven’. Het boekje begint met de alleszins pragmatische onderscheiding tussen dingen die wél in je macht liggen en dingen die niet in je macht liggen. Het is verspilde energie om je bezig te houden met die laatste categorie dingen. Wat zijn dan de elementaire dingen waarop je je moet concentreren? De dingen waarin je wil een rol speelt, zegt Epictetus. Houd je eenvoudig bij je mogelijkheden. Je kunt je nergens (meer) aan hechten, dus moet je springen...
Je moet je niet bezighouden met onnodige dingen in je leven, zegt Epictetus in zijn Encheiridion, het ‘Handboekje voor het morele leven’. Het boekje begint met de alleszins pragmatische onderscheiding tussen dingen die wél in je macht liggen en dingen die niet in je macht liggen. Het is verspilde energie om je bezig te houden met die laatste categorie dingen. Wat zijn dan de elementaire dingen waarop je je moet concentreren? De dingen waarin je wil een rol speelt, zegt Epictetus. Houd je eenvoudig bij je mogelijkheden. Je kunt je nergens (meer) aan hechten, dus moet je springen...
Ik heb aldoor het gevoel dat er een verband bestaat tussen de ‘gewone’ situaties (waarin je moet onderscheiden tussen het nodige en het onnodige) en de grenssituaties (die terugkeren in élke situatie). Daarom nu even een bocht naar Jaspers.
Grenzsituation: zentraler Begriff in der Philosophie von K. Jaspers: Erfahrungen, in denen der Mensch die Grenzen seines Erkennens, Wollens und Handelns erfährt (z. B. Leiden, Schuld, Sterben) und die im Bewusstsein des Scheiterns zur Selbstwerdung des Menschen führen können und in der Gewinnung »wirklicher Existenz« die Transzendenz durchscheinen lassen. Zou je kunnen zeggen dat je in grenssituaties leert wat ‘nodig’ en ‘onzin’ is in je leven? De existentiefilosoof Jaspers (1883-1969) zegt dat een mens die “er is” (Dasein), nog niet bereikt heeft wat een mens kan zijn. De mens kan in vrijheid het “zelfzijn” (Existentie) bereiken. Die stap, a giant leap, is echter hypothetisch: de mens heeft wegens de ‘geborgenheid’ van de uiterlijke omstandigheden een aanzet nodig die hem op zijn eigen existentie terugwerpt. Dit noemt Jaspers grenssituaties. Hij ziet dood, strijd, lijden en schuld als mogelijke katalysators die kunnen bijdragen tot het doorbréken van de oppervlakkige houvast, tot de ontsnapping aan het Dasein.
Zou je kunnen zeggen dat je in grenssituaties leert wat ‘nodig’ en ‘onzin’ is in je leven? De existentiefilosoof Jaspers (1883-1969) zegt dat een mens die “er is” (Dasein), nog niet bereikt heeft wat een mens kan zijn. De mens kan in vrijheid het “zelfzijn” (Existentie) bereiken. Die stap, a giant leap, is echter hypothetisch: de mens heeft wegens de ‘geborgenheid’ van de uiterlijke omstandigheden een aanzet nodig die hem op zijn eigen existentie terugwerpt. Dit noemt Jaspers grenssituaties. Hij ziet dood, strijd, lijden en schuld als mogelijke katalysators die kunnen bijdragen tot het doorbréken van de oppervlakkige houvast, tot de ontsnapping aan het Dasein.
‘Wat in het aangezicht van de dood wezenlijk blijft, is existentie; wat broos wordt, is louter bestaan.’
Het tragische echter is niet zozeer verbonden met de dood zelf, als wel met de omwenteling die de dood (of een andere grenssituatie) teweeg brengt bij de mens die het moet verwerken. Op zo’n moment immers botsen orde en wanorde, zonder enige synthese – beide gelijktijdig als overwinnaar en verliezer. De fundamentele agon die in de tragedie gedramatiseerd wordt is de spanning tussen onpeilbare gebeurtenissen – mysterie, klaarblijkelijk toeval, extreme omstandigheden – en de orde, betekenis en lot die de menselijke geest zich construeert om te kunnen functioneren.
Karl Jaspers is waarschijnlijk duidelijker als hij zegt dat de mens de dood, het lijden, de strijd, de schuld en het noodlot moet aanvaarden en als hij dit in alle eerlijkheid doet, kan hij in de grenssituaties tot een echte existentie komen. Ook hij noemt het dan een sprong uit de vertwijfeling naar het ‘zelf zijn’. De sprong vanuit de angst naar de rust is de meest fantastische sprong die de mens kan doen. Waarna hij tot de conclusie komt dat je die sprong niet eigenmachtig kunt maken, maar dat het de ervaring is van het geschonken worden. Alleen met de rug tegen de muur, als de mens niets meer te verliezen heeft, kan dat in deze maatschappij gebeuren. Het is dus niet een sprong die je buiten de werkelijkheid, maar juist de werkelijkheid in voert, maar wel uit de maatschappelijke werkelijkheid. Je komt dan niet aan waar je je nergens meer aan kunt hechten, maar juist omdat je nergens meer aan hecht kun je die sprong maken. De val in de afgrond brengt je wel buiten het door ruimte en tijd ingeklemde beschaafde bestaan, maar in een werkelijkheid waar alleen nog maar de natuurwetten gelden en niet door mensen bedachte wetten en normen.
Tot zover Jaspers.
Wie Seneca drängt auch Epiktet auf dauernde Selbsterziehung. Mehr als andere Stoiker betont er, dass der Anfang allen Philosophierens in der Erkenntnis der eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit liegt. Er empfiehlt die regelmässige Selbstprüfung und will sie sogar nicht nur in der Abendstunde, sondern nach jeder Handlung vorgenommen wissen. Er schätzt auch die einsame Selbstbesinnung und warnt vor schlechtem Umgang. Er schärft ein, dass ständige Übung notwendig ist, wenn sittliche Fortschritte gemacht werden wollen. Die Tugend beruht ganz und gar auf dem richtigen Wissen, das, wie Epiktet oft bemerkt, nicht leichthin und nebenher, sondern nur durch methodisches Studium und praktische Übung wirklich angeeignet werden kann.
Epictetus (Grieks: Ἐπίκτητος) was een Stoïcijns filosoof uit de 1e eeuw na Chr.; hij leefde van 50 tot ca. 130 na Chr. Hij werd als Griekse slaaf naar Rome gebracht, vrijgelaten en vervolgens verbannen. Na zijn vrijlating onderwees hij, aanvankelijk in Rome en later in Nikopolis (Griekenland), de filosofie van de Stoa, in een door hem gestichte school. Zelf heeft Epictetus niets geschreven, maar zijn leerling en bewonderaar Arrianus heeft zijn voordrachten en uitspraken genoteerd in het zg. Encheiridion.
In ‘Le souci de soi’ bestudeert Foucault de eerste twee eeuwen van onze jaartelling en met name de filosofie van Epictetus. Epictetus definieert de mens als ‘het wezen dat zijn bestaan wijdt aan de zorg voor zichzelf’. Volgens Foucault is niet ‘Ken uzelf’, maar ‘Draag zorg voor uzelf’ het eerste beginsel van de antieke ethiek. Foucault ontwaart in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling een intensivering van de morele zelfverhouding. Zelfzorg is volgens hem het belangrijkste thema van de filosofie in deze tijd. Een belangrijk onderdeel van de zelfbetrekking is het zelfonderzoek dat erop is gericht de balans op te maken van de vorderingen die men heeft geboekt. Deze vorm van zelfverhouding zet Foucault af tegen de christelijke morele problematisering die, hoewel ze uiterlijk veel overeenkomsten vertoont, wezenlijk verschilt van de wijze waarop de antieke mens zich tot moreel subject constitueert.
Epiktet wurde in den Jahren zwischen 50 und 60 nach Christus im phrygischen Hierapolis, dem heutigen türkischen Pamukkale, geboren.
Epiktets Name bedeutet “der Hinzuerworbene“. Er war ein Sklave des Leibwächters und Vertrauten von Kaiser Nero, Epaphroditos. Zu dieser Zeit war es üblich, dass sich wohlhabende Römer Sklaven mit Bildung gehalten hatten. Epiktet war ein Schüler des Stoikers G. Musonius Rufus gewesen.
Epiktet wurde später freigelassen. Danach hielt er Vorträge über den Stoizismus und verbreitete so die philosophische Lehre. Etwa um das Jahr 90 wurde er durch ein Dekret des Kaisers Domitianus zusammen mit anderen Philosophen aus Rom verwiesen. Er erlitt ein ähnliches Schicksal wie vor ihm bereits Seneca. Epiktet siedelte nach Nikopolis im westgriechischen Epirus über. Dort eröffnete er eine philosophische Schule, die er aufbaute und dessen Leiter er bis zu seinem Tod blieb.
Seine Schule wurde bald bekannt und seine Lehren genossen eine hohe und verbreitete Akzeptanz. Selbst Kaiser Hadrian als auch Kaiser Marc Aurel begeisterten sich für Epiktets Philosophie. Auch Aurelius Augustinus, einer der wichtigsten Denker der frühchristlichen Patristik, stufte Epiktet als einen der wichtigsten späten Stoiker ein.
Epiktet soll nach kynisch-asketischen Vorstellungen Bedürfnislosigkeit vorgelebt haben. Außer ein paar Dinge zum Leben wie Decke, Lampe oder Strohsack soll er keine weiteren Habseligkeiten besessen haben. Damit lebte er vor, was er in seiner philosophischen Lehre anpries, nämlich sich auf das wirklich Wichtige im Leben zu beschränken und konzentrieren. Damit stand er ganz im Gegensatz zu Seneca, der ein wohlhabender Stoiker die Bedürfnislosigkeit als tugendhaft predigte und damit einen offensichtlichen Widerspruch zwischen Lehre und Realität vorlebte.
Sokrates galt Epiktet als Vorbild. Wie er hielt er seine Lehren nicht schriftlich fest. So basieren die Überlieferungen seiner Lehren auf den Mitschriften Epiktets Schüler. Eine sehr treffende Überlieferung der moralischen Schriften von Epiktet, den sogenannten Diatriben, sind die Schriften von Flavius Arrianus, dem späteren Biograph Alexanders des Großen. Arrianus überlieferte mit dem Titel „Unterredungen“ Epiktets Lehren. Ein Teil daraus bilden das „Handbüchlein der Moral“, das sich besonders in der Spätantike als trostspendendes Hausbuch großer Beliebtheit und Verbreitung erfreute.
Epiktets Auffassung von Philosophie bedeutete in der Hauptsache das Gebiet der Ethik. Die Begründung sittlichen Handelns lag für ihn im Glauben an eine zweckgerichtete Welt. Der Zweck wurde von der Vernunft bestimmt, die göttlichen Ursprungs war. Die Erfüllung des menschlichen Daseins sah Epiktet darin, dass sich der Mensch durch den Gebrauch seines Willens in die Weltordnung harmonisch einbringt. Glückseligkeit erreicht der Mensch, wenn er sich von allen seinen Begierden löst und unabhängig davon ist. In seiner Lehre trat Epiktet für die Gleichheit aller Menschen ein. Gegenüber dem Staat und der Ehe hielt er sich in ablehnender Distanz.
Was steht im Machtbereich des Menschen? – das war der erste Grundsatz in seiner Philosophie. Epiktet zählte alles Äußere, den Besitz, die äußere Stellung oder das Ansehen zu denjenigen Dingen, über die der Mensch seinen Einfluss nicht geltend machen kann. In seiner Lehre von der Bedürfnislosigkeit begründete er, dass es nicht diese Dinge selbst seien, die dem Mensch Glückseligkeit bedeuteten, sondern allein die Vorstellungen von diesen Dingen. Dagegen sah er es in der Hand des Menschen gelegen, dass ihn sein eigenes Denken und Begehren glücklich machen könnten.
Als Vertreter der Stoa war auch Epiktets Lehrtätigkeit auf die Physik, die Logik und die Ethik beschränkt. Der Schwerpunkt seiner Lehre lag dabei im Bereich der Ethik und dort im Speziellen auf den Themen Sittlichkeit und Religiosität. Durch diese Schwerpunkte hatte Epiktets Lehre starken Einfluss auf das frühe Christentum. Augustinus noemde hem ‘de edelste der stoicijnen’.
Nach der Lehre Epiktets soll der Mensch strikt unterscheiden, welche Dinge und Geschehnisse von ihm selbst beeinflusst werden können und welche nicht. Nur wenn diese Unterscheidung gelingt und bewusst wird, dann wird persönliches Glück erreichbar sein. Dabei soll der Mensch in den Dingen, die in seiner eigenen Macht stehen, einen eigenen Lösungsweg suchen, während er die Dinge, die er nicht beeinflussen kann, in (stoischer) Ruhe über sich ergehen lassen bzw. als gegeben akzeptieren soll. Daher soll der Mensch auch nicht über das verärgert sein, was sich aufgrund der Gesetze der Natur oder des Willens einer Gottheit ergibt.
Ein wichtiger Aspekt der Lehre Epiktets ist, dass die Grundsätze dem Einzelnen nicht nur bekannt sind, sondern im täglichen Leben angewandt werden.
Sein Leitsatz war: „Ertrage und entsage“, „sustine et abstine“.
Wesentlich bekannter als die »Unterredungen« wurde das »Encheiridion«, das »Handbüchlein der Moral«. Hier hatte Arrian in knapper Darstellung - gewissermaßen für den eiligen Leser oder auch für den, der einen Tagesspruch suchte - die wichtigsten Lehrsprüche Epiktets zusammengestellt.
Während erhebliche Teile der Diatriben verlorengingen, blieb das »Handbüchlein« bis auf den heutigen Tag vollständig erhalten. Das mag nicht zuletzt daran gelegen haben, daß die Kirche der christlichen Spätantike die Eignung dieser Schrift für die moralische Unterweisung erkannte. Um alle Hinweise auf das Heidnische zu löschen, wurden die Textstellen entfernt, die man für anstößig hielt. Man ersetzte den Namen Sokrates durch Paulus und gab als Verfasser den Asketen Nilus an. So wurden seine Lehren von Augustinus bis Blaise Pascal beachtet.
Epiktet orientierte sich in seiner Lehre an der älteren Stoa, überging also die mittlere Phase, zu der Panaitios und Poseidonios gehören - er nennt nicht einmal ihre Namen - und knüpfte an die geradlinigen Aussagen Zenons und vor allem Chrysipps an. Im Gegensatz zu diesen richtete sich aber sein Hauptinteresse fast ausschließlich auf die Ethik, lediglich der Logik räumte er - als Instrument des wissenschaftlichen Denkens - einen größeren Platz ein. Seine Armut war Ausdruck der Entscheidung, sich auf das Wichtige im Leben auszurichten. Während verständlicherweise Marc Aurels »Selbstbetrachtungen« immer wieder Gefahren und Vergänglichkeit der Macht reflektierten, konzentrierte sich Epiktets Lehre, konsequenter als die Senecas, auf die Frage nach dem sittlich richtigen Leben. Er forschte nicht nach der Wahrheit wie manche seiner Vorgänger, er kannte sie: Deshalb predigte und lehrte er.
Fundament der Lehre Epiktets ist die Einteilung, Dihairesis, der Dinge in die, welche in der Macht des Menschen stehen, und in solche, worüber der Mensch nicht verfügt. Beispiele für den ersten Bereich sind: Vorstellungen, Triebe, Begierden, Abneigungen, für den zweiten: Leib, Ansehen, Besitz. Anders gesagt: Ob sich der Mensch ärgert oder freut, von welchem Blickwinkel er die Dinge sieht und welche Bedeutung er ihnen zumißt, das entscheidet er in freier Selbstbestimmung, und dafür trägt er die Verantwortung. Hier fördert oder verfehlt er seine Sittlichkeit. Wer sich um die Entwicklung seines Inneren kümmert, ist frei, ist auf dem richtigen Weg und wird sein Lebensziel erreichen. Alles andere wie Ehre, Tod, Besitz, Krankheit entzieht sich seiner ausschließlichen Verfügung. Deshalb muß er sich um diese Dinge nicht kümmern, es sind »Adiaphora«, sittlich gleichgültige Dinge wie etwa auch Lust, Schmerz, Ansehen und Besitz. Sie beeinflussen den Menschen nur, wenn er es zuläßt. Sie kommen auf ihn zu, wie das Schicksal es will. Es liegt also nicht an ihm, er muß nur lernen, sie mit Gleichmut zu behandeln.
Wer sein Leben an diese äußeren Dinge hängt, wird unglücklich werden »und mit Gott und Menschen im Streit liegen«, sagt Epiktet im Enchiridion. Welche Dinge des Lebens der Mensch für die wichtigsten hält, hängt von einer grundsätzlichen Vorentscheidung, der Prohairesis, ab. Er muß entscheiden, was er für gut und richtig ansieht, wofür er sich einsetzen will. Die richtige Vorentscheidung ist die, sich um die »eigenen« Dinge zu kümmern, also um die, über die man Macht hat; das ist die sittliche Grundentscheidung, die jeder Mensch zu treffen hat. Sie liefert ihm die Wertmaßstäbe für sein Handeln, gibt ihm die Kraft, das Rechte zu wollen - der Begriff des »Wollens« ist bedeutsam für Epiktet - und einen festen Standpunkt für seine Selbsterziehung einzunehmen. Das Telos, das dem Menschen innewohnt, ist - modern gesprochen - seine Identität: Eins zu sein mit sich selbst und damit zuletzt mit dem göttlichen Logos, das ist die Grundforderung des tiefreligiösen Epiktet. Für ihn ist Gott immerfort gegenwärtig, ihm verdanken die Menschen ihre gesamte Existenz, in seinen Willen sollen sie sich widerstandslos ergeben, denn er will nur ihr Bestes.
Woensdag 29 augustus 2007 – Sartre: ‘L'homme est condamné à être libre’
 Over Jean-Paul Sartre heb ik nog steeds gemengde gevoelens. Aan de ene kant weet ik zeker dat de mens absoluut vrij is, maar aan de andere kant weet ik ook hoe hij zijn/haar vrijheid kan kwijtraken. De mens is nu eenmaal geen baas in eigen leven (Freud). Maar hij is intussen wel ‘condamné à être libre’. Hij is helemaal vrij, maar toch ook weer niet. Doet denken aan Paulus: 'Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij'. Zoiets.
Over Jean-Paul Sartre heb ik nog steeds gemengde gevoelens. Aan de ene kant weet ik zeker dat de mens absoluut vrij is, maar aan de andere kant weet ik ook hoe hij zijn/haar vrijheid kan kwijtraken. De mens is nu eenmaal geen baas in eigen leven (Freud). Maar hij is intussen wel ‘condamné à être libre’. Hij is helemaal vrij, maar toch ook weer niet. Doet denken aan Paulus: 'Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij'. Zoiets.
Over wat ik hier over Sartre verzamel zweeft die ambiguïteit, waar Sartre het overigens ook zelf moeilijk mee gehad heeft. Freud heeft hem altijd gestoken. En over de manier waarop Sartre spreekt over ‘de anderen’ ben ik eigenlijk niet te spreken. Maar zijn uitspraken over ‘condamné à être libre’ leiden mij altijd in verzoeking, waar ik dan vandaag maar aan toegeef. Eigenlijk komt hier mijn oude vraag weer naar boven: ben je als mens ‘eenzaam’ of ‘tweezaam’? Ik geloof in ‘tweezaam’, maar ik denk ‘eenzaam’.
Dus:
Denn statt mit einer Ontologie (wie der Untertitel von Das Sein und das Nichts nahelegt), haben wir es mit einer Anthropologie zu tun: der Bestimmung der Seinsweise des Menschen, in deren Mittelpunkt Sartre den Begriff der Freiheit stellt. "Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt" - weil er sich immer wieder neu entwerfen muss, vor der Wahl steht und sein momentanes Sein negieren und überschreiten muss, immer auf der Suche nach einer Identität, die nie zu erreichen ist, weil ein Riss durch das menschliche Sein geht, der nie verschwindet.
Besonders faszinierend sind die Abschnitte, die sich mit den zwischenmenschlichen Beziehungen befassen. Denn Sartre analysiert das Verhältnis zum anderen auf sehr originelle Weise: über den Blick. Andererseits rückt er zwei Phänomene exemplarisch in den Vordergrund, die von der Philosophie meist sträflich missachtet werden - das Begehren und die Liebe.
Over de blik schrijft Levinas ook. Met de blik van de ander wordt mijn afgeslotenheid doorboord. Satre spreekt over de blik ‘van’ de ander, Levinas over ‘het gelaat’ van de ander.
Die Grundlage Jean-Paul Sartres Philosophie ist es, dass die Existenz des Menschen die Voraussetzung für sein Wesen ist. Der Mensch wird ins Leben geworfen; er existiert, ob er will oder nicht. Existieren heißt aber für den Menschen, Möglichkeiten in Wirklichkeit umzuwandeln. Dadurch ist er dazu verurteilt, Entscheidungen zu treffen. Dem kann man sich nicht entziehen, denn auch der Entschluss alle Entscheidungen Anderen zu überlassen, einem Moralprinzip zu folgen und selbst der Entschluss zum Freitod, der endgültigen Flucht aus der Existenz, muss selbstständig getroffen werden.
Der Mensch hat immer mehr als eine Möglichkeit - er ist frei - und er muss sich entscheiden (keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung) - damit ist er zur Freiheit verurteilt.
Diese Freiheit wird, wie es auf den ersten Blick scheint, durch die anderen Menschen gefährdet. "Die Hölle, das sind die Anderen" (Gabriel Marcel zegt: ‘De hemel, dat zijn de anderen’), weil sie den Einzelnen ständig auf etwas festlegen wollen und mit ihren Erwartungen die Freiheit, sich immer wieder neu zu entscheiden, eingrenzen. Es wird kaum einem möglich sein, den Blick der Anderen völlig zu ignorieren; in irgendeiner Form (Anpassung oder Rebellion) reagiert jeder darauf.
Sartre zeigt jedoch auch, dass die eigene Freiheit immer die Freiheit aller Anderen einschließt. Ein Mensch kann seine Freiheit nicht gegen die Freiheit der Anderen ausspielen, weil er nur frei sein kann, wenn sie es auch sind. Neben den konkreten, anderen Menschen gibt es aber noch die gesellschaftlich geprägten Vorstellung, die in unseren Köpfen sitzen, dazu unten mehr.
Die völlige Freiheit stellt den Menschen vor eine große Verantwortung, da er sich für alles, was er tut, entschieden hat und damit für seine Handlungen und ihre Folgen verantwortlich ist. Problematisch sind dabei Entscheidungen, die nicht bewusst getroffen wurden.
Sartre bezeichnet es als die vordringlichste Aufgabe jedes Menschen, sich seine eigene Welt zu schaffen, indem er sie entwirft. Diesem individuellen »Entwurf« der Welt steht der Mensch allein gegenüber, der Entwurf geschieht ohne jedes Einwirken seitens der Gesellschaft und ohne moralische oder religiöse Unterstützung. Der Mensch ist dazu verdammt, die eigene Existenz stets neu zu entwerfen – seine Existenz ist ein stets zu realisierender Entwurf. Dabei vermag der Mensch im Unterschied zur nichtmenschlichen Welt etwas zu verneinen, sich gegen etwas zu entscheiden oder sich aufzulehnen.
Indem Sartre die Verantwortung aller Menschen für ihre Entscheidungen voraussetzt, postuliert er die absolute Freiheit, die Bedingungen für eine menschliche Existenz wählen zu können: Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. So wird sich der Mensch seiner selbst bewusst und ist gezwungen, aus der Freiheit heraus sein Leben zu verwirklichen, Werte und Sinn zu wählen und sich zu entwerfen.
Der Mensch ist nach Sartre nicht definierbar, weil er anfangs überhaupt nichts ist. Er wird erst, und er wird so sein, wie er sich geschaffen hat. Demnach, so urteilt Sartre, gibt es keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, um sie zu entwerfen: Die Existenz geht dem Wesen, der Essenz, voraus.
Wirkung: Sartre erregte mit Das Sein und das Nichts ein so breites öffentliches Interesse, dass der Existenzialismus zu einer weltweiten Bewegung wurde. Internationalen Ruhm erlangte Sartre, indem er die Begriffe »An-sich« und »Für-sich«, die Hegel geprägt hatte, neu interpretierte, um damit das Weltverständnis der Menschen als ein ursprünglich sinnentleertes und das Verhältnis der Menschen untereinander als ein von Natur aus gewalttätiges zu demonstrieren.
Eine der bekanntesten existentialistischen Äußerungen, die jedoch sinngemäß schon bei Schelling nachgewiesen werden kann, ist die Aussage Sartres „Die Existenz geht der Essenz (dem Wesen) voraus“, aus der Schrift Der Existentialismus ist ein Humanismus.
Thematisch angeknüpft wird hier an die Wesensbestimmung (Essenz) des Menschen in der Philosophie. Durch die Bestimmung des Menschen als biologisches Wesen, als Vernunftwesen, als göttliches Wesen etc., erhält der Mensch vor seiner Existenz zunächst schon eine Bedeutung, eben biologisch, vernünftig, gottähnlich. Beim Existentialismus kritisiert man diese, der Existenz vorgängige Sinnbestimmung und setzt ihr die Existenz entgegen: Der Mensch ist als Mensch nicht zu erfassen, wenn nicht je von seiner eigenen individuellen Existenz ausgegangen wird. Jede Wesenbestimmung enthält, so die Kritik durch den Existentialismus, immer schon einen Theorieaspekt, der sich nicht aus einer unmittelbaren Erfahrung der Existenz speist, sondern der Existenz „nachrangig“ gebildet wird.
Hieraus erklärt sich auch die Fokussierung des Existentialismus auf die Themen Angst, Tod, Freiheit, Verantwortung und Handeln als elementar menschliche Erfahrungen. Der Mensch versteht sich selber nur im Erleben seiner selbst. Demnach bezieht sich der Existentialismus nicht mehr auf eine göttliche oder kosmologische oder quasigöttliche Ordnung, sondern entwickelt seine Theorie vom Einzelnen aus. Dadurch wird eine religiöse Grundhaltung nicht abgelehnt (auch wenn dies häufig durch die Schriften Sartres intendiert wird), sondern der Glaube wird vielmehr selbst zum existentiellen Erleben.
In Begriffen wie Geworfenheit, Selbstentwurf, Freiheit und Selbstbestimmung zeigt sich die Zentrierung des Existentialismus auf das Problem der Befreiung des Menschen zu seinen eigenen Möglichkeiten hin. Die Notwendigkeit dieser Möglichkeit zu sein, zeigt sich in den Erfahrungen von Absurdität, Ekel, Angst, Sorge, Tod und Langeweile und zeigt eindrucksvoll auf, dass gerade dieses subjektive Empfinden das Leben des Menschen bestimmt, Objektivitätsansprüche vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen verblassen.
„Der atheistische Existentialismus, für den ich stehe, ist zusammenhängender. Er erklärt, dass, wenn Gott nicht existiert, es mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dass dieses Wesen der Mensch oder, wie Heidegger sagt, die menschliche Wirklichkeit ist. Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert.” (Jean Paul Sartre, 'Der Existenzialismus ist ein Humanismus')
Das philosophische Hauptwerk Sartres Das Sein und das Nichts (L'être et le néant, 1943) gilt gleichzeitig auch als wichtigstes theoretisches Fundament des Existentialismus. Hier zeigt er auf, dass sich das menschliche Sein (Für-Sich), von dem anderen Sein, den Dingen, Tieren, Sachen etc. (An-Sich) durch seinen Bezug zum Nichts unterscheidet.
Der Mensch ist ein Sein, „das nicht das ist, was es ist, und das das ist, was es nicht ist”.
Als einziges Wesen, das verneinen kann, einen Bezug zu dem Noch-Nicht oder Nicht-Mehr hat, das lügen kann, also das sagen, was nicht ist, hat der Mensch damit auch die Bürde der Freiheit und damit auch die Verantwortung. Das Hauptwerk zeigt in eindrucksvollen Analysen menschlicher Situationen, wie sich die Freiheit in allen Bezügen des Seins des Menschen aufdrängt, der Mensch vor dieser Verantwortung flieht und wie der konkrete Bezug zum Anderen ihm erst diese Verantwortung und Freiheit aufzeigt. Das Vorurteil, dass es sich bei dem Existentialismus sartrescher Prägung um einen egoistischen Individualismus handelt, kann so nicht aufrechterhalten werden. Im Gegenteil: In seinen Analysen zeigt der Philosoph auf, dass menschliches Leben niemals als vereinzeltes Leben verstanden werden kann. Die dafür notwendigen Analysen sind, mit Einschränkung, wahrscheinlich die stärksten philosophischen Argumente gegen jeglichen Solipsismus.
Methodisch geht Sartre phänomenologisch vor, indem er die oben genannten Existentiale wie Freiheit, Furcht, Angst, Liebe, Scham als Zeugen für die Freiheit des Menschen befragt. Durch diese Analysen gelangt er schließlich auch zu dem Anderen als mir gegenübertretende Freiheit und zeigt auf, dass unsere Freiheit und Verantwortung eine ontologische Entsprechung hat. Somit kann Sartre zwar keine moralischen Forderungen stellen, bejaht aber solche grundsätzlich, wenngleich sie auch von überindividuellen Bezügen abgelöst werden muss und ihre eigentliche Entsprechung in der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen findet.
„Aber wenn wirklich die Existenz der Essenz vorausgeht, so ist der Mensch verantwortlich für das, was er ist. Somit ist der erste Schritt des Existentialismus, jeden Menschen in Besitz dessen, was er ist, zu bringen und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. Und wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist, so wollen wir nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine Individualität verantwortlich ist, sondern dass er verantwortlich ist für alle Menschen.”
Nun findet sich aber gerade hier häufig der Einwand, warum Menschen denn dann unmoralisch handeln bzw. ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, wenn wir doch frei sind. Der Mensch hat nach Sartre einen Bezug zum Nichts eben dadurch, dass er in seiner eigenen Seinsstruktur selber Nichts ist, d.h. der oben zitierte Satz bringt zum Ausdruck, dass wir selbst immer wieder vor der Verantwortung fliehen können: Sartre nennt diese ontologische Struktur des Menschen „mauvaise foi“, die Unaufrichtigkeit oder Selbstlüge. Er beschreibt, wie wir in der Selbstlüge zugleich Lügner und Belogener in einer Person sind und zeigt auf, warum dieses offensichtlich logisch Widersinnige nachzuvollziehen ist: Da wir offensichtlich nicht eindeutig zu bestimmen sind, wie die Analyse der mauvaise foi nahe legt, tätigen wir immer wieder einen sog. Entwurf.
„Der Mensch ist zuerst ein Entwurf, der sich subjektiv lebt, anstatt nur ein Schaum zu sein oder eine Fäulnis oder ein Blumenkohl; nichts existiert diesem Entwurf vorweg, nichts ist im Himmel, und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein geplant hat, nicht was er sein wollen wird. Denn was wir gewöhnlich unter Wollen verstehen, ist eine bewusste Entscheidung, die für die meisten unter uns dem nachfolgt, wozu er sich selbst gemacht hat. Ich kann mich einer Partei anschließen wollen, ein Buch schreiben, mich verheiraten, alles das ist nur Kundmachung einer ursprünglicheren, spontaneren Wahl als was man Willen nennt”.
In seinen literarischen Werken wird dieses Thema, Entwurf und Änderung eines Grundentwurfes immer wieder zum Thema gemacht.
Citaten Jean-Paul Sartre:
* Existieren, das ist dasein, ganz einfach; die Existierenden erscheinen, lassen sich antreffen, aber man kann sie nicht ableiten
* Denn die dialektische Totalisierung muss die Handlungen, die Leidenschaften, die Arbeit und die Bedürfnisse ebenso wie die ökonomischen Kategorien umfassen, sie muss gleichzeitig den Handelnden wie das Ereignis in den historischen Komplex einordnen, ihn im Verhältnis zur Richtung des Werdens definieren und genauestens den Sinn der Gegenwart bestimmen.
* Wenn die Existenz dem Wesen vorausgeht, das heißt, wenn die Tatsache, dass wir existieren, uns nicht von der Notwendigkeit entlastet, uns unser Wesen erst durch unser Handeln zu schaffen, dann sind wir damit, solange wir leben, zur Freiheit verurteilt...
* Das "Paradoxe unserer historischen Situation" bestehe darin, dass "unsere Freiheit heute [...] lediglich der freie Entschluss, die Freiheit zu erkämpfen", sei.
* Der Marxismus wird zu einer unmenschlichen Anthropologie degenerieren, wenn er nicht den Menschen als seine Grundlage reintegriert
* ... es gibt keine Auswege zu wählen. Ein Ausweg, der wird erfunden
* Nicht die "Härte einer Situation und die von ihr auferlegten Leiden" sind Motive "dafür, dass man sich einen andern Zustand der Dinge denkt, bei dem es aller Welt besser ginge; im Gegenteil, von dem Tag an, da man sich einen anderen Zustand denken kann, fällt ein neues Licht auf unsere Mühsale und Leiden und entscheiden wir, dass sie unerträglich sind.”
Dinsdag 28 augustus 2007 - Gilles Deleuze & Félix Guattari: ‘De mens is een nomade: hij heeft geen wortels, maar benen...’
 ‘Pensée nomade’
‘Pensée nomade’
‘Although the rhizome and the nomad are inseparable in the sense that the rhizome is the path that the nomad follows...’
De twee begrippen waar het allemaal om draait: rhizoom (woekerende wortels en zo...) en nomade. De twee foto's zijn van Gilles Deleuze (filosoof, 1925 - 1995) en Félix Guattari (Lacaniaans psychiater en filosoof, 1930 - 1992).
(Deze bijdrage is heel lang en eigenlijk wel heel belangrijk. Er liggen lijnen naar Levinas, maar die komen misschien nog weleens naar voren. De teksten borduren voort op Lyotard: worden, je bent wat je wordt. Maar worden is zwervend op weg gaan, op weg naar iets wat je niet kent. Op weg gaan naar ergens, maar het gaat om de weg en om de beweging. En dat 'niet weten', dat 'wagen', dat doet denken aan Abraham en zo. Nou ja, als je het kunt volhouden, struin dan door deze teksten. Excuus voor de afmeting...).
In philosophy, the term rhizome has been used by Carl Jung as a metaphor, and by Gilles Deleuze as a concept, and refers to the botanical rhizome.
Carl Jung used the word "rhizome", also calling it a "myzel", to emphasize the invisible and underground nature of life:
‘Life has always seemed to me like a plant that lives on its rhizome. Its true life is invisible, hidden in the rhizome. The part that appears above the ground lasts only a single summer. Then it withers away — an ephemeral apparition. When we think of the unending growth and decay of life and civilizations, we cannot escape the impression of absolute nullity. Yet I have never lost the sense of something that lives and endures beneath the eternal flux. What we see is blossom, which passes. The rhizome remains.’ (Prologue from "Memories, Dreams, Reflections")
Het was Gilles Deleuze die het denken van Nietzsche bestempelde als een 'nomaden-denken' - zijn essay met dezelfde titel uit 1972 was een van zijn eerste, in het Nederlands vertaalde teksten (1981). De boeken van Deleuze worden vandaag geplunderd door kunstenaars, muzikanten en activisten. Slogans, samples en citaten duiken overal op en begrippen als nomadisme, rizoom, chaosmose, verlangenmachines en schizo-analyse worden bijna achteloos gebruikt om hedendaagse kunstpraktijken te rechtvaardigen. Het spelen met verschillende identiteiten wordt 'nomadisch' genoemd, de twijfel aan lineariteit heet nu 'chaosmose' en elektronische soundscapes zouden 'rizomatisch' zijn. Ten dele rechtvaardigt Deleuze het 'anything goes'-gebruik van deze termen door zijn concepten - in Nietzsche's voetspoor - aan te prijzen als gereedschappen en wapens. Anderzijds echter is Deleuze heel specifiek en concreet in het gebruik van concepten die nooit als metafoor mogen worden gezien. Zo zijn de nomaden van Deleuze geen metafoor voor iets anders, maar verwijzen zij weldegelijk naar de levenswijze van nomaden. Wat zijn nomaden?
Nomaden bestaan bij de gratie van voortdurende verplaatsing en bevinden zich aan de periferie van een territoriaal en administratief apparaat dat vanuit een centrum wordt bestuurd. Hier, aan de periferie, laten ze zich niet overcoderen door de wet, het contract en de institutie - de drie belangrijkste codes van elke beschaving - maar decoderen zij zichzelf voortdurend door geen centrum te ontwikkelen en zich frequent te verplaatsen. In hun levenspraktijk onttrekken zij zich aan gevestigde codes. Voor onverplaatsbare eigendommen, grote kunstwerken en musea, voor een stadsontwikkeling of staatsvorming, is hier geen enkele plaats. Nomaden, zegt Deleuze, zijn ‘oorlogsmachines’, die zich mobiliseren tegen de despoot en zijn bureaucratie - de ‘bestuursmachine’. Stirner en Nietzsche, maar ook Duchamp, zijn in Deleuzes filosofie oorlogsmachines, die de conventies van wet, contract en institutie decoderen en opnieuw coderen door gebruik te maken van ironie, kruisbestuivingen, dwarsverbanden en overlappingen. Wie deze codes in het ongerede brengt, vervolgt Deleuze, kan niet anders dan heilzaam, hartelijk en Dionysisch lachen:
"In plaats van de angsten van ons benepen narcisme of de verschrikkingen van de schuldigheid bereikt ons uit grote boeken het schizo-lachen of de revolutionaire vreugde. Grote boeken zijn altijd een bron van onbeschrijflijk plezier, zelfs wanneer zij over lelijke, ontmoedigende en schrikaanjagende dingen gaan. Wanneer je het denken in relatie tot het buiten brengt, dan ontstaan momenten van een Dionysisch lachen, dat is het denken in de open lucht. Het aforisme is de zuivere materie van de lach en van de vreugde. Wanneer je in een aforisme niets hebt gevonden dat je aan het lachen brengt, dan heb je helemaal niets gevonden".
‘Deleuze may be familiar with the ‘spiritual nomadism’ of the free spirits, their ‘access to many and contradictory modes of thought’...’
Within the realm of nomadism, everything can provisionally be functioned into material towards a future whose shape and location isn't fixed yet - material towards something new. When Deleuze calls Nietzsche's aphorism nomad thoughts, he characterizes them as being 'in immediate relation with the outside, the exterior' (Deleuze, 1977: 144).
One of the problems of thinking nomadic thoughts in the theatre is the very bounded, boxed nature of conventional theatre. Nomadism is a playful mode of being in thought, and it is this quality that precludes a minimalist, formalist conception of an original theatre - the nomadic lies in extension rather than boundary. At the same time, the connection to the exterior, the embeddedness of nomad thought invites a re-visit of the theatre. In this re-visit, the theatre emerges as a space in which different times, conceptions of reality, and of the public and its spaces, of the human and the becoming-other meet and touch. Nomadic theatre: theatre in process, lacking direction (iii) . Nomadic theatre: a theatre of chance, of material, of wandering without aim (iv) .
As a laboratory of the nomadic, then, my reading here shall erect the theatre as a hall of mirrors. It becomes a ruin of technologised half-forgotten relations. It emerges as a curiosity cabinet, curiously inhabited, as fingers trail over dusty exhibits. Thus, instead of consigning theatre and its modes of address to the teleology of the history museum, I want to let a theatre of nomadism emerge as a wunderkammer, a curiosity cabinet, a form preceding the order of the museum and the archive. In this wunderkammer, theatre lives as an extended field of collection and of unknown assemblages.
Whereas the rectilinear (or 'regularly' rounded) Egyptian line is negatively motivated by anxiety in the face of all that passes, flows, or varies, and erects the constancy and eternity of an In-Itself, the nomad line is abstract in an entirely different sense, precisely because it has a multiple orientation and passes between points, figures, and contours: it is positively motivated by the smooth space it draws, not by any striation it might perform to ward off anxiety and subordinate the smooth. The abstract line is the affect of smooth spaces, not a feeling of anxiety that calls forth striation (Deleuze and Guattari, 1987: 496-7).
This nomadicism of the journey within the field of the curtain aims neither at an exoticising of the non-Western, nor at a sense of the nomadic as a non-location, a globalised, dispersed, non-participatory spatiality. Instead, in my phenomenological witnessing, the nomadic theatre emerges as a nonsense space of traversed images and stories. It makes strange landfalls, and connects different points in different archives of knowledge. Within the amalgamation of histories, gears, levers, curtains and flesh, the body does feel - does engage in affective connections, creating machines of meaning-making. As my attention teeters on the edge of the theme park and the theatre, I am reminded that what I do with these intensities and arrangements is my decision: the ethical demand of a nomad space that allows for difference is to 'become the child of one's own event' (Deleuze and Parnet, 1987: 65) - to exist towards futurity. The nomadic is never a place to live: as minor and major performance transmute into one another, the nomadic become reterritorialized. But the intense capacities and the extensive relations become visible on the horizon of the possible. They exist in virtuality, infecting productively thought and action. As Deleuze and Guattari remind their reader, smooth space as such is not liberatory. The nomad is not a saviour, and not a revolutionary to build a new state.
As Deleuze and Guattari remind their reader, smooth space as such is not liberatory. The nomad is not a saviour, and not a revolutionary to build a new state.
But the struggle is changed or displaced in [smooth spaces], and life reconstitutes its stakes, confronts new obstacles, invents new paces, switches adversaries (Deleuze and Guattari, 1987: 500).
Smooth space is open space, what Deleuze & Guattari call ‘nomadic’, in opposition to the striated which is space of closure – ‘sedentary’, bordered ‘State’ space: The space of nomad thought is qualitatively different from State space. Air against earth. State space is ‘striated’, or gridded. Movement in it is confined as by gravity to a horizontal plane, and limited by the order of that plane to preset paths between fixed and identifiable points. Nomad space is ‘smooth’, or open-ended. One can rise up at any point and move to any other. Its mode of distribution is the nomos: arraying oneself in an open space (hold the street), as opposed to the logos of entrenching oneself in a closed space (hold the fort). (Massumi, 1988, p. xiii).
The certainty and stability of logos which inhabits striated space – the Word, law, the ‘metaphysical signified’, the ‘word of the citadel, the fort, the court, the boss, the suits’ – is opposed here to the wandering, metamorphosing nomos, the ‘word of the street’ (Mahoney, 2002). Where smooth space is informal andamorphous, striated space is formal and structured. Striated space is associated with arboreal, hierarchical thought, which Deleuze & Guattari oppose to rhizomatic thought – non-hierarchical, underground, multiply-connected.
Movement happens differently within each of these spaces. Smooth space is a space of becoming, of wandering (nomad space), where the movement is more important than the arrival. In striated space, what is most important is arrival at the point towards which one is oriented: ‘In striated space, lines or trajectories tend to be subordinated to points: one goes from one point to another. In the smooth, it is the opposite: the points are subordinated to the trajectory’ (Deleuze & Guattari, 1988, p. 478).
The technological model Deleuze & Guattari provide as illustrative of these two types of space is one of textiles. Here, woven fabric is necessarily a striated space, with its gridlike form consisting of intersecting warp and weft. It is a space of closure: ‘the fabric can be infinite in length but not in width, which is determined by the frame of the warp; the necessity of a back and forth motion implies a closed space’ (p. 475). It bears within itself a hierarchy, a top and a bottom. By comparison, felt (the fabric of the nomads) is an ‘anti-fabric’ representing smooth space, ‘it is in principle infinite, open, and unlimited in every direction; it has neither top nor bottom nor center; it does not assign fixed and mobile elements but rather distributes a continuous variation’ (pp. 475-476).
Within the musical model, the striating functions of warp and weft are replaced by harmony and melody, and while the desert, steppe, or ice (unpossessed, metamorphosing, open) are representative of smooth spaces, the sea is ‘smooth space par excellence’, subject to striation within the maritime model by the principles of navigation – meridians and parallels, longitude and latitude. If the sea is the ultimate figure of smooth space, the extreme of striation is the city (p. 481).
What is important about this conceptualisation of space is not so much the way the two types of space are opposed to each other as their tendency to pervade each other – for striation to appropriate the smooth, and for the smooth to emerge from the striated (p. 500). Thus the closing passage of Deleuze & Guattari’s essay offers the key point: Of course, smooth spaces are not in themselves liberatory. But the struggle is changed or displaced in them, and life reconstitutes its stakes, confronts new obstacles, invents new paces, switches adversaries. Never believe that a smooth space will suffice to save us. (p. 500).
Rhizom
von Jörg Seidel
...was in Wirklichkeit nicht darstellbar ist, weil es ein Rhizom ist, eine unvorstellbare Globalität.
Umberto Eco
Die öffentlichen Reaktionen in Deutschland auf den Tod von Gilles Deleuze waren höchst unterschiedlich, was sich anhand des medialen Umgangs leicht nachvollziehen lässt. RTL etwa scheute nicht davor zurück, in einer der kulturellen Legitimationssendungen im Rahmen der Reihe "News und Stories" dem Philosophen eine einstündige Sendung zu widmen - ein Gespräch, das Alexander Kluge mit dem Übersetzer wichtiger deleuzescher Werke [1], Joseph Vogl, führte. Und auch "Die Zeit" erachtete das Ereignis als wert, ihm fast eine halbe Seite offenzuhalten, die der Leipziger Philosoph Ulrich Johannes Schneider füllte, ebenfalls ein ausgewiesener Kenner des Denkens von Foucault und Deleuze, und auch er hat sich als Übersetzer verdient gemacht [2].
Anders dagegen der "Spiegel". Er widmete dem Tod von Deleuze noch nicht mal eine ganze Spalte unter der Rubrik "Gestorben" auf der vorletzten Seite. Mehr informativ als würdigend, ringt man sich durch, doch wenigstens den Sprachwitz zu erwähnen und erinnert an die eine oder andere gelungene Wortschöpfung des Denkers. Im kontradiktorischen Gegensatz zum einstigen Euphemismus Foucaults [3] resümiert der "Spiegel": "Mancher solcher Wort-Funde wird in Erinnerung bleiben" - darüber, was von Deleuze und dessen Denken bleiben kann. Man mag zu dieser Vergessensprognose stehen, wie man will, unleugbar jedenfalls ist, dass der Terminus des "Rhizoms" schon längst zu diesen Wort-Funden zählt.
Die Vokabel, die erstmals im vorab veröffentlichten Vorwort zu "Tausend Plateaus" erscheint [4], dürfte zur mittlerweile bekanntesten, wenn nicht populärsten gehören, die fast schon identifikatorische Macht ausübt und damit beginnt, die Zwecke ihrer Schöpfer zu überwuchern. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb Deleuze den Terminus später nicht mehr aufnimmt. Spätestens seit Eco seinen Weltbestseller, die Zeichenwelt des William von Baskerville und das ominöse Labyrinth als Rhizom, rhizomförmig und Rhizom-Labyrinth kenntlich machte [5], dürfte der Begriff geläufig geworden sein, hat er die Grenzen esoterischer Kaderschmieden der Philosophie überschritten. Erneut nach dem Rhizom zu fragen, kann sich also nur noch mit einem neuen Gegenstand legitimieren. Bezeichnenderweise hat der Begriff sich längst vom Werk von Deleuze und Guattari gelöst, man liest ihn allerorten, im philosophischen Fachbuch ebenso wie in der philosophischen Belletristik, in der Literatur nicht anders als im Rockmagazin, aber auffälligerweise wird er selten mit Inhalt gefüllt, vielmehr beschränkt man sich auf die biologische Metaphorik, auf informationstechnische Subsumierungen oder glaubt einfach an den Zauber einer ungewöhnlichen Vokabel. Nicht, dass damit einer Art Besitzanspruch des Begriffes im deleuzeschen Sinn zugesprochen werden soll, so verliert er doch durch diesen laxen Umgang an Schärfe, Aussagekraft, letztlich an Sinn. Es kann daher nicht schaden, den Terminus textnah und pragmatisch-funktionell, zu rekapitulieren. Sicher der Begriff des "Rhizoms" ist keine ureigene Erfindung der beiden, er stammt aus der Botanik und benennt einen Wurzeltyp bei bestimmten Pflanzen, der morphologisch eher als Spross, Stängel oder Trieb beschrieben werden muss. Es kann sowohl ober- als auch unterirdisch wuchern, treibt dabei ohne erkennbare Ordnung Triebe, die Knoten bilden, aber auch sich kreuzen können. Was Wurzel, was Trieb ist, bleibt unentschieden, beides steht in ständigem Austausch mit der Umwelt. Schon strukturell vom Baum unterschieden, ist es auch sich selbst nicht eindeutig identisch, d.h. es hat nicht wie der Baum ein Größenwachstum, sondern stirbt, einmal eine gewisse Größe erreicht, am alten Ende ebenso ab, wie es sich am treibenden verjüngt, so dass es nach einiger Zeit ein vollkommen anderes, erneuertes Gewächs darstellt.
Ein Missverständnis läge vor, wollte man das Rhizom für die Philosophie als Metapher dingfest machen. Deleuze hielt nie viel von Metaphern ("Wir machen absolut keinen metaphorischen Gebrauch von diesen Begriffen... Wir meinen das so, wie wir es sagen: buchstäblich". [6]), ja er zweifelte sogar an deren Existenz [7]. Dagegen tritt es in mehrfacher Bedeutung auf, die, wenn man sie auch voneinander differieren kann, nicht immer voneinander zu trennen sind. So bildet das Rhizom eine ontologische Kategorie, die die "Struktur" von Sein, von Welt beschreibt. Wohlgemerkt, demnach ist die Welt nicht wie ein Rhizom, sie ist ein Rhizom oder sie macht Rhizom, wie die Autoren es nennen. Der ontologische Status der Rhizomatik wird durch zahlreiche Analogien aus dem Naturbereich bestätigt, wenn etwa die Quecke, das Unkraut bemüht wird, die Ameisen, Ratten, der Tierbau, das Wespe-Werden der Orchidee und das Orchidee-Werden der Wespe, die DNS und Viren bis hin - in der etwas erweiterten Fassung in "Tausend Plateaus" - zur Hirnphysiologie und -anatomie [8]. "Die Natur geht so nicht vor" [9] – wie man bislang glaubte und in den verschiedensten Baummetaphern sich vorzustellen hatte. Auch wenn die Natur als letzter Bezugspunkt fungiert, so beschränkt man sich doch nicht auf sie, ist vielmehr bemüht Phänomene außerhalb des natürlichen Bereichs aufzuspüren, um das Rhizom zum einen verständlich, zum anderen aber schon um selbst Rhizom zu machen. So kommt es, dass von Amsterdam, Amerika, von Musik und Literatur, Bürokratie und Ökonomie, Geographie und Geschichte die Rede ist.
Das Rhizom fungiert desweiteren als epistemologische Kategorie, die den Vorgang des Denkens und damit des Erkennens beschreibt. Wichtig ist hier die analogische Herangehensweise: "Der Baum und die Wurzel zeichnen ein trauriges Bild des Denkens." (26) und später: "Das Denken ist nicht baumförmig, und das Gehirn ist weder eine verwurzelte noch eine verzweigte Materie" [10]. Der gesamte Bereich des Buches in "Rhizom", der Agitation für ein rhizomatisches Buch, ein rhizomatisches Lesen und Schreiben, aber auch der geäußerten Aversion gegen die Metaphorik der Welt als Buch und dem Buch als Wurzelbaum, spielt in die epistemologische Dimension hinein. Insofern die epistemologische Kategorie die Wucherung in die ontologische Kategorie forciert bzw. diesen Sachverhalt beschreibt, und weil sie einander entsprechen, miteinander verwachsen sind, ist das Rhizom auch als eine "moralische" oder eine imperativische Kategorie, als eine Art umgekehrter kategorischer Imperativ auszumachen. "Macht Rhizom, nicht Wurzeln, pflanzt nichts an! Sät nicht, stecht! Seid nicht eins oder viele, seid Vielheiten! ... Lasst keinen General in euch aufkommen!" (41).
Aber bevor die Idee des Rhizoms exemplifiziert wird, stecken Deleuze und Guattari das Terrain ab, zeigen, wovon sich das Rhizom (als Buch) absetzt. Da ist zum einen das Wurzelbuch, Welt und Denken als Baum oder Wurzel gedacht, das die Idee der Klassik - von der Antike bis Descartes, Kant und der hegelschen Dialektik - darstellt. Gemeinsames Merkmal aller: "Die binäre Logik ist die Realität des Wurzelbaums" (8), die weit in die Moderne (Chomskys syntagmatischer Baum, Psychoanalyse) hineinreicht. Es ist das Denken der Einheit (selbst wenn diese aus Gegensätzen besteht), des Ursprungs und der Identität, das die Vielheiten noch nicht mal zu denken wagte, geschweige denn ihnen gerecht wurde.
Anders dagegen "die büschelige Wurzel oder das System der kleinen Wurzeln" (9), wie es die Moderne charakterisiert. "Die Hauptwurzel ist (hier) verkümmert, ihr Ende abgestorben, und schon beginnt eine Vielheit von Nebenwurzeln wild zu wuchern". Wirklich anders? Deleuze und Guattari verneinten diese Frage und versuchen darzulegen, dass das Büschelwurzelbuch an der entscheidenden Stelle die Idee der Vielheit verfehlt, denn zwar vermag es - und ist durch die gesellschaftliche "Entwicklung" auch dazu gezwungen - die Vielfalt der Erscheinungen der äußeren Welt zu reflektieren, aber nur, indem ein starkes identisches Subjekt dies leistet. Damit ist nicht nur die Dualität des Denkens noch nicht beseitigt, sondern "während die Einheit im Objekt fortwährend vereitelt wird, triumphiert im Subjekt ein neuer Typ von Einheit" (40), statt den klassischen Monismus prinzipiell aufzuheben, gelingt es lediglich, den der objektiven Welt in Pluralismus zu wandeln, auf Kosten eines noch zentralistischeren Subjekts, so dass sich im Umkehreffekt "eine totalisierende Einheit dann um so mehr durchsetzt" (10). Das moderne Denken gerät in einen Widerspruch, den die Autoren mit dem Begriff des "Würzelchen - Chaosmos" verdeutlichen, in dem die Antagonismen Chaos und Kosmos (Weltordnung) zusammengepresst werden. Dass das durchaus legitim sein kann, wird noch zu sehen sein, nur kennt das moderne Denken keine Möglichkeit, Grundverschiedenheit und Zusammenhang zusammen, überhaupt Antinomien widerspruchslos zu denken. Sich die Vielheit auf die Fahnen zu schreiben, reicht nicht aus, man muss einen Schritt weitergehen, den Schritt zum Rhizom. "Es genügt eben nicht zu rufen: Hoch lebe das Viele (multiple)! so schwer es auch sein mag, diesen Schrei auszustoßen. ... Das Viele (multiple) muss man machen..." (10f.) und sein. [11] Um zu verdeutlichen, wie das zu bewerkstelligen sei, bieten die Verfasser eine Formel an: "n – 1 schreiben". Was heißt das? Wenn man über das Viele schreiben möchte und dabei die chaosmische Selbstwidersprüchlichkeit, die das Eine im Schreiben über das Viele neu konstituiert, zu umgehen versucht, dann darf man eben nicht einheitlich, vollständig, vollkommen, endgültig (versuchen) das Viele zur Sprache bringen, sondern muss das Viele in die Sprache einführen und diese als Einheit zerlegen. Das Viele tatsächlich zu thematisieren heißt, es vielfältig zu tun und die Minimaldifferenz ist eben das Eine, das davon abgezogen wird. Eine einheitliche Thematisierung des Vielen wird also niemals selbst Vieles sein und machen. Und anders herum, man muss immer eine Lücke lassen, immer ein Wort, einen Satz, eine Aussage zu wenig machen, man muss vermeiden, den Text abzuschließen, abzurunden, um ihn vielmehr offen zu halten, zu öffnen. Zu verhindern sei die Ganzheit des Ganzen bei Gewährleistung der Ganzheit (Konsistenz) des Vielen, der Teile. "Ein solches System" - wenn es denn gelingt - "kann man Rhizom nennen" (11). Das schreit förmlich nach positiver Bestimmung, denn bislang wurde hauptsächlich herausgearbeitet, was ein Rhizom vom Wurzel- und Büschelwurzelmodell unterscheidet. Zu dieser Einsicht gelangten auch die Verfasser, und sie beginnen nachfolgend "wenigstens annäherungsweise bestimmte Merkmale des Rhizoms" aufzuspüren, sechs an der Zahl, aber die Äußerung lässt vermuten, dass es noch mehr geben könnte, ja eventuell sogar, dass Deleuze und Guattari selbst sich nicht in der Lage sehen, alle zu benennen.
Erstes Prinzip ist das der Konnexion und zweites das der Heterogenität, aber diese beiden werden als "1. und 2." zusammen genannt, sie sind nur zusammen und zugleich zu denken. Das mag - oberflächlich betrachtet - nach der dialektischen Figur des Kampfes und der Einheit der Gegensätze klingen, jedoch darf man nicht vergessen, dass es sich hier nicht um Negationsverhältnisse handelt, sondern um Differenzen und dass zweitens die beiden Prinzipien nicht punktuell zusammengepresst werden, sondern sich linear überschneiden. "Jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann und muss mit jedem anderen verbunden werden" (11). Dass damit ein Denkweg eröffnet wurde, der grundlegende Denkschwierigkeiten und bislang ungelöste Probleme auch in der sogenannten postmodernen Philosophie überwindet, hat, am Beispiel Lyotards, Wolfgang Welsch deutlich gemacht, wonach rhizomatisches Denken imstande ist, "das einzulösen, was sich zuletzt als vernunfttheoretisches Desiderat herauskristallisiert hat: Differenzen und Übergänge zu verbinden" [12]. Da wächst also nicht zusammen, was vermeintlich zusammen gehört, nein, Rhizom machen die Dinge vor allem "insofern sie heterogen sind" (17) - und das auf allen Ebenen. "Ein Rhizom verknüpft unaufhörlich semiotische Kettenteile, Machtorganisationen, Ereignisse in Kunst, Wissenschaft und gesellschaftlichen Kämpfen. Ein semiotisches Kettenglied gleicht einer Tuberkel, einer Agglomeration von mimischen und gestischen, Sprech-, Wahrnehmungs- und Denkakten: es gibt keine Sprache an sich, keine Universalität der Sprache, sondern einen Wettstreit von Dialekten, Mundarten, Jargons und Fachsprachen" (12). Die Bestandteile werden also nicht miteinander vermischt, zu einem Amalgam vergossen, sondern bleiben - wenn freilich nicht unverändert - als Heterogenität in der Konnexion erhalten, sie werden eben nicht vereinigt (und auch nicht wiedervereinigt), sie bleiben statt dessen als Vielheiten bestehen.
Das "Prinzip der Vielheit" ist das dritte interne Charakteristikum des Rhizoms. Eine Vielheit - das substantivierte, nicht mehr zuschreibbare Viele - "hat weder Subjekt noch Objekt; sie wird ausschließlich durch Determinierungen, Größen und Dimensionen definiert, die nicht wachsen, ohne dass sie sich dabei gleichzeitig verändert" (13). Das Rhizom ist folglich nicht durch das Viele, durch viele Einzel- und Einheiten konstituiert, es besteht vielmehr aus Dimensionen, deren Zahl sich erhöht, je mehr Verbindungen, je mehr Kombinationen geschaltet, verkettet werden. "Eine Verkettung ist gerade diese Zunahme der Dimensionen in einer Vielheit, die sich in dem Maße automatisch verändert, in dem sich ihre Konnexionen vermehren" (14). Diese Vieldimensionalität, die sich zahlenmäßig ändern kann, und die permanente Veränderbarkeit führen dazu, dass das Rhizom paradoxerweise "keine supplementäre Dimension" kennt und andererseits, dass man es nicht durch den bestimmten Artikel, der immer eine Einheit und Identität transportiert, bezeichnen kann, ja noch nicht einmal der unbestimmte Artikel, der noch immer ein gewisses Maß an Einheit stiftet, erweist sich als adäquat. Das Rhizom, die Vielheiten werden "durch Teilungsartikel bezeichnet (etwas Quecke, etwas Rhizom)" (15).
"Das Prinzip des asignifikanten Bruchs" besagt, dass ein Rhizom an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden kann, "es wuchert entlang seinen eigenen oder anderen Linien weiter" (16). Hier müssen kausalistische, genealogische und deterministische Vorstellungen verabschiedet werden, denn "Entwicklungen" gibt es nur als nicht-, als aparallele. "Rhizom machen" heißt, mit diesen Beziehungen zu brechen, um sie mit Hilfe transversaler Verbindungen neu zu denken. So ist das Buch nicht etwa Bild der Welt, sondern "es gibt eine aparallele Evolution von Buch und Welt", so ahmt die Orchidee auch nicht die Wespe nach, sondern da treffen sich aparallele Evolutionen, das Krokodil vollbringt keine mimetische Leistung, wenn es dem Baumstamm im Wasser gleicht usw. usw. Etwas macht mit etwas anderem "Rhizom machen". Dem Rhizom ist nicht zu entkommen. "Weisheit der Pflanzen: auch wenn sie Wurzeln haben, gibt es immer ein Außen, wo sie 'Rhizom machen' - mit dem Wind, mit einem Tier, mit dem Menschen" (19). So besagt das Prinzip des asignifikanten Bruches mehr, als dass Rhizome gebrochen werden können, insofern auch das Rhizom in tradierte Verbindungen ein- und diese zerbricht. Da dies vollkommen entsprechungsfrei und bezugslos geschieht, kann von Asignifikanz gesprochen werden.
Blieben "5. und 6. - Prinzip der Kartographie und Dekalkomonie" (20), das die Differenz zwischen Karte und Kopie thematisiert. "Ein Rhizom ist keinem strukturalen oder generativen Modell verpflichtet. Es kennt keine genetischen Achsen oder Tiefenstrukturen" (20), die dagegen als Prinzipien der Kopie zu gelten haben. Das Wesentliche der Karte ist ihre Offenheit, "sie kann in allen ihren Dimensionen verbunden, demontiert und umgekehrt werden, sie ist ständig modifizierbar" (21). Während die Kopie als Baum- oder Wurzelprinzip sich immer nur selbst reproduziert, aus eins zwei macht, letztlich also "immer 'auf das Gleiche' hinausläuft" (22), setzt die Karte auf die schier unbegrenzbare Zahl ihrer Ein-, Aus- und Umgänge: "Man kann sie zerreißen und umkehren; sie kann sich Montagen aller Art anpassen; sie kann von einem Individuum, einer Gruppe oder gesellschaftlichen Formation angelegt werden. Man kann sie auf Mauern zeichnen, als Kunstwerk begreifen, als politische Aktion oder als Meditation konstruieren. Vielleicht ist es eines der wichtigsten Merkmale des Rhizoms, viele Eingänge zu haben; " (21).
Natürlich ruft ein so unerwartetes, neues und verunsicherndes Denken Kritiken hervor, immerhin stellt es alte Wissenschaftstraditionen zur Disposition und reißt sie in eine Legitimationskrise. So gesehen wurde wohl zu Recht vom "Paradigma des Rhizoms" [13] gesprochen, aber der Paradigmenbegriff ist seit Kuhns paradigmatischer "Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen" [14] nicht mehr frei verfügbar. Eine dieser Kritiken verdient besondere Beachtung, weil sie nicht aus "konservativer" Position heraus ansetzt, weil sie sich also nicht selbst verteidigen muss und weil sie von einem Denker stammt, den man oft noch in einem Atemzug mit Deleuze, Foucault, Derrida - kurz, den Postmodernen - nennt. Die Schelte Baudrillards ist als Kritik "von vorn" besonders aufschlussreich, beruft sie sich doch statt auf ein "zu viel" oder "zu weit" auf ein "zu kurz". Schon ein Jahr nach Erscheinen von "Rhizom" antwortet Baudrillard mit einer kleinen Schrift, die den programmatischen Titel "Oublier Foucault" [15] trägt, auch auf das Büchlein von Deleuze und Guattari. Zum einen wirft er den beiden vor, nach dem Ende der theologischen und teleologischen Macht, die Teleonomie - quasi als immanente, affirmative Eschatologie - an deren Stelle gehievt und damit die Struktur wieder eingeführt zu haben, zum anderen beunruhigt ihn "eine merkwürdige Komplizenschaft mit der Kybernetik" [16]. In der Tat gehen Deleuzens rhizomatische Vorstellungen, die man auch als Netzwerk zu begreifen versuchte, mit den technischen Mechanismen konform, bestätigen mit dieser Kompatibilität eine Entwicklung, die nicht nur für Baudrillard unerträglich ist. Andererseits ist nicht ganz auszumachen, wieso die reine Deskription - vom imperativischen Teil abgesehen - Destruktivismen und Negativismen forcieren sollte, ja, es ist sogar fraglich, ob der megamaschinelle status quo überhaupt propagiert wird. Baudrillard freilich geht von dieser Konsequenz aus. "Genau diese geheime Übereinstimmung muss deutlich (und lächerlich) gemacht werden. Heutzutage gilt es als chic und revolutionär, sich im Molekularen herumzutreiben" [17]. Letztlich ist aber auch er nicht vor der Apodiktizität gefeit, wenn er, möglicherweise mit ironischem Unterton, zusammenfasst: "Eine weitere Spiralwindung der Macht, des Wunsches und des Moleküls, die uns diesmal endgültig und unverhüllt mit der absoluten Kontrolle konfrontiert. Hütet euch vor dem Molekularen" [18]. Vielleicht ließe sich eine Annäherung erreichen, wenn man, statt vom auf-der-Hut-sein, vom gesunden Misstrauen spricht, und dieses scheint in der Tat angebracht. Gerade dem Paradigmatischen des Rhizoms ist zu misstrauen...
Dass etwas ein Rhizom ist, kann nicht heißen, alle rhizomatischen Bestandteile auffinden zu wollen, denn selbstredend enthält, auf der einen Seite, die Idee des Rhizoms einen gewissen idealtypischen Anteil - der Rattenbau z.B. ist streng betrachtet durchaus kein (reines) Rhizom - auf der anderen Seite beinhaltet jegliches Rhizom auch Baum- und Wurzelstrukturen, auch Strukturen jenseits der angedeuteten Charakteristika; es ist damit mehr als ein Rhizom, ebenso wie es weniger ist.
Am Auffälligsten dürfte die als Vernetzung, partiell als Puzzle - durchaus auch im Doppelsinne von zu Verbindendem und Rätsel - auftretende Gesamtkonstellation innerhalb eines Werkes sein, die weder beliebig funktioniert noch gewalttätige Vereinnahmungen und Verabsolutierungen gestattet [19]. Es wäre also, um dies zusammenzufassen, möglich - sofern das überhaupt möglich ist - die reinen Phänomene rhizomartig zu strukturieren, aber es wäre auch überflüssig, denn das Rhizom strukturiert, schafft sich selbst, so dass es vollkommen ausreicht, an die Wahrnehmung und an den Willen zur Wahrnehmung des Rezipienten zu appellieren. Die ist insofern gegeben, als die Emanationen alle in einem Punkt sich bündeln, nämlich in ihrem Schöpfer - das kann nie anders sein -, aber der selbst ist nicht der klassische Identitätstyp. "Jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann und muss mit jedem anderen verbunden werden", schrieb Deleuze, und man wird nicht umhin können, hier Abstriche zu machen, denn ob tatsächlich jeder beliebige Punkt mit jedem anderen zu verbinden ist, bleibt sicher fraglich, aber das muss nun nicht als Defizit entziffert werden. Vielmehr scheint es doch so, dass gerade dieses "jeder" und auch dieses "muss" ob ihrer Absolutheit gewisse totalitäre Tendenzen - nicht zu verwechseln mit den Vorwürfen von Welsch - andeuten. Nichtsdestotrotz ist es möglich, nahezu jeden beliebigen Punkt des Rhizoms mit nahezu jedem anderen zu verbinden, in den verschiedensten Dimensionen aufeinander zu beziehen, auch in Hinblick auf die "verschiedenen Codierungsarten", die den Philosophen vorschwebten. Das heißt, "in einem Rhizom verweist nicht jeder Strang notwendig auf einen linguistischen Strang: semiotische Kettenglieder aller Art sind dort nach den verschiedensten Codierungsarten mit politischen, ökonomischen und biologischen Kettengliedern verknüpft; es werden also nicht nur ganz unterschiedliche Zeichensysteme ins Spiel gebracht, sondern auch verschiedene Arten von Sachverhalten" (12).
So jedenfalls ließen sich die rhizomatischen Strukturen - diesbezüglich vergleichbar mit den sich selbst ähnlichen Strukturen, auf die Prigogine verwies - bis in die kleinsten Verästelungen nachvollziehen, bis auf die Ebene des Molekularen, des mikroanalytischen Bereichs zurückverfolgen.
Ihr Äquivalent im "großen und ganzen" lässt sich nicht minder aufzeigen. Man könnte darunter etwa jenes "Verfahren" sehen, das Deleuze und Guattari mit "n – 1 schreiben" wiedergaben, also das Machen des Vielen mit Hilfe der Auslassung des Einen, sprich die Unvollständigkeit. Eben der Verlockung widerstehen, ein Großes und ein Ganzes herzustellen! Nichts abrunden, nichts abschließen. Nicht die Form, die Systematik zum Diktator machen, nicht den Inhalt in Form gießen, sondern frei fließen lassen, "es" seinen Weg nehmen lassen und nicht furchtsame Verantwortlichkeiten konstruieren. Der Inhalt ist schon eine Form, und er hat seine eigene Systematik. Dies als schön empfinden zu können, ist keineswegs eine Frage kategorialer Apriorismen oder Transzendentalitäten, es ist eine Frage des Willens zur Wahrnehmung, eine Frage der Affirmation. Insofern ist auch der Werk-Begriff, der bislang unbekümmert genutzt wurde, fehl am Platze, er kann nicht mehr als eine Hilfsvokabel sein, denn gerade darum geht es, kein Werk zu schaffen, statt dessen zu werken. Wo das Werk sich tendenziell konstituiert, sich in Form gießt, zur Einheit gerinnt, muss es permanent hinterfragt werden, und nötigenfalls muss man derartigen Prozessen aktiv entgegenwirken. Dies ist innerhalb der Darstellung mit Hilfe des Prinzips des Bruchs möglich, um Ganzheiten, Schönheiten, Feinheiten meist dann zu zerstören, wenn sie am schönsten sind. Erwartungen sind im Rhizom einzig dazu da, enttäuscht zu werden. Der Bruch kann dabei die verschiedensten Variationen erfahren, er kann ein Abbruch, ein Einbruch oder Umbruch sein, er kann als Schnitt, Knick oder Knacks, als Falte oder Welle daherkommen, er kann das Ende oder einen Anfang bedeuten, er kann Riss oder Spalt, Kluft oder Hiatus sein, und er vermag sogar als Brücke zu fungieren, dann nämlich, wenn er erwartet wird, wenn das Prinzip des Bruchs zu brechen ist. Entscheidend ist einzig, nie alles zu sagen, sagen zu wollen. Dieses quasi-systematische Verfehlen eines Aussagesinns (oder einer Aussageform), eröffnet durch seine Absenz einen weitgefächerten assoziativen Raum voller möglicher Bedeutungen. So kann nur jemand sprechen, der das postmoderne Dilemma des Sprechens begriffen hat. Das "Problem der Schrift: nur mit ungenauen Ausdrücken kann man etwas genau bezeichnen. Nicht, weil man da hindurch müsste oder immer nur durch Annäherungen vorankäme: die Ungenauigkeit ist keineswegs eine Annäherung, sie ist im Gegenteil der genaue Verlauf der Ereignisse" (33).
Rhizomorphe Bücher:
Das alles gilt auch in Bezug auf die Außenseite des Werkes. "Der abendländische Leser wartet auf das Schlusswort" [20], und just diese Erwartung ist zu enttäuschen. Es ist, mit Botho Strauß, von Beginnlosigkeit die Rede und folglich auch von Endlosigkeit. Die Verwunderung darüber ist nichts anderes als der Hinweis, dass hier die Grenzen verschwimmen, dass hier Rhizom gemacht wird. Rhizmorphe Bücher beginnen nicht, sie sind einfach da, sie entbehren phasenweise der Sukzession und oftmals wird mit der Gleichzeitigkeit gespielt. Vor allem aber haben sie, im Gegensatz zum Wurzelbuch, keinen Plot, sind weitestgehend plan- und ideenlos [21]. Die Bücher selbst sind rhizomorphe Bücher [22], wie das Werk rhizomorph ist. Daher enden sie auch nicht, sondern sie sind einfach nicht mehr da, eher als vollführten sie eine substantielle Veränderung, als entglitten sie in die vierte Dimension, als dass sie abgeschlossen wären. Sie sind, wenn man so will, im Sinne des Wortes, geil. Auch der Begriff der Geilheit ist ursächlich ein botanischer, wo er als Synonym für wuchern gilt. Die geile Pflanze wächst üppig, treibt kräftig, schlingt wild, wuchert - sie macht Rhizom wie: "eine Rose ist eine Rose ist eine Rose...".
Schizo und Nomade:
"Jede Vielheit", schreiben Deleuze und Guattari, "die mit anderen durch an der Oberfläche verlaufende unterirdische Stängel verbunden werden kann, so dass sich ein Rhizom bildet und ausbreitet, nennen wir Plateau. Wir schreiben dieses Buch als Rhizom" (35). In erster Linie bezieht sich diese Aussage natürlich auf das Buch "Tausend Plateaus", als dessen Vorwort das kleine Rhizom-Büchlein fungierte, doch ist hier von "jeder" Vielheit die Rede. Eines der grundlegenden Charakteristika des zweiten Teils von "Kapitalismus und Schizophrenie" ist die (versuchte) Aufhebung der Sukzessivität und Linearität des Textes, der wiederum auch in seinen Bestandteilen als gleichzeitig gelesen werden kann.
Das lässt sich, um hier anzuknüpfen, auch auf die anthropologische und psychologische Ebene anwenden, es findet auch da seine Korrelate. Die Figur des "Schizo" gehört zu den Zentralgestalten des Denkens von Deleuze und Guattari. Es ist die Figur, die ihr "mehrere-sein" bejaht und die deshalb nicht mit dem klassischen Schizophrenen der Psychoanalyse zu verwechseln ist, der unter seiner Spaltung leidet und sie einem Leid "verdankt". Deshalb sind die Probleme des Schizos "wenigstens wirkliche Probleme, nicht Probleme von Neurotikern" (51). Er stellt seine Identität immer wieder zur Disposition, er wechselt sie und spielt mit ihr, ohne je zur identitätslosen Masse zu verkommen. Schon Nietzsche warnte: Verwechselt mich nicht! Er, der Schizo, ist der Eine, der Viele ist, mit vielen Stimmen spricht, mit den Maskierungen spielt, er ist immer unterwegs - und verfehlt, weil er keines mehr hat, stets sein Ziel, mehr noch, dieses Verfehlen selbst ist das Ziel: "dicht daran vorbeistreifen, das ist das Schizo-Gesetz" [23].
Die anthropologische Entsprechung ist der Nomade. "RHIZOMATIK = NOMADOLOGIE" (37), fassen der Philosoph und der Psychoanalytiker lakonisch zusammen. Der "Nomadologie" ist in "Tausend Plateaus" ein "zentrales" Kapitel gewidmet. Der Mensch hat, wie Dietmar Kamper einmal so einfach wie überzeugend anführte, keine Wurzeln, sondern Füße, sein stetiges Unterwegssein entspricht seiner Natur, seinem Wesen, wenn man so will. Der Weg des Nomaden führt nicht von A nach B; jenseits moderner Mobilitätsillusionen kennt er keinen Ziel-Ort - etwas, wovon der Fahrer immer noch träumt -, denn es ist allein der Weg, der sein Ziel ist. Dieser fügt sich den natürlichen Gegebenheiten: dort, wo das Leben ist, ist der Nomade. So stiftet er ständig neue, unerwartete Verbindungen, lebt eher in einem topologischen denn geschichtlichen Raum, hat eine größere Geographie als eine längere Geschichte. "Dabei kennen die Nomaden durchaus Punkte, zu denen sie 'immer wieder gerne' zurückkommen. Nomadisches Denken erlaubt es durchaus, immer wieder einmal beispielsweise zu Kant zurückzukommen oder an ihm vorbeizukommen. Aber was ihm zutiefst zuwider wäre, wäre ein Denken, das einen 'Standpunkt' hätte, von dem aus gefälligst gedacht werden müsste und für den dann jeweils die dezisionistische Irrationalität gelten müsste: hier stehe ich, ich kann nicht anders. Statt seiner gilt im nomadischen Denken die postmoderne Parole: hier stehe ich - ich kann auch noch ganz anders" [24]. Es ist dann nur folgerichtig, wenn Welsch mit Bezug auf die Vernunft die Transversalität als "Modus von Übergängen" gerade anhand der Nomadologie einführt, ist es doch der Nomade, der die Gegensätze verknüpft, und zwar nicht (nur) in paradoxaler Form, um sie so - ohne viel Aufhebens - geil wuchern zu lassen. "Lieber ein unmerklicher Bruch als ein signifikanter Schnitt. Die Geschichte hat nie das Nomadentum begriffen. Für diejenigen schreiben, die nicht lesen können" (39).
Wenn es aber das Signum des Nomaden ist, das Denken nicht als Ort, sondern als Weg zu begreifen, wenn er sich also im Zustand des Werdens statt des Seins befindet, dann wird statt des Ergebnisses die Bewegung zum Kriterium, dann kann nicht nach Vollkommenheit, Perfektion oder gar Richtigkeit gefragt werden, sondern muss die Originalität, Kreativität und die Wichtigkeit über den Wert eines Denkens entscheiden. In der Tat nähert sich dadurch der Philosoph dem Künstler mehr an, wie er sich vom strengen Wissenschaftler unterscheidet, und umgekehrt hat der Künstler die Möglichkeit erhalten, zum Philosophen zu werden. Nicht wie ein Philosoph soll der Künstler werden - das gerade nicht! - vielmehr steht die Aufgabe eines Philosoph-Werdens des Künstlers und des Künstler-Werdens des Philosophen.
[1] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung. München 1992
Deleuze, Gilles: Francis Bacon - Die Logik der Sensation. München 1995
Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Frankfurt 1996
[2] Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Frankfurt 1996
Deleuze, Gilles: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. München 1993
[3] Foucault, Michel: Theatrum Philosophicum. In: Deleuze/Foucault: Der faden ist gerissen. Berlin 1977
[4] Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie. Berlin 1992
[5] Eco, Umberto: Nachschrift zum "Namen der Rose". München 1987. S. 65)
[6] Deleuze, Gilles/Parnet, Claire: Dialoge. Frankfurt 1980 S. 25
[7] vgl. ebd. 11/126 u.a.
[8] vgl. Deleuze, Gilles: Unterhandlungen 1972 - 1990. Frankfurt 1993 S. 217
[9] Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Rhizom. Berlin 1977. S. 8 (alle nachfolgend in einfache Klammer gesetzte Seitenangaben beziehen sich auf dieses Buch)
[10] Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Tausend Plateaus. S. 28, /Hervorhebung J.S.)
[11] Hier genügt Nietzsche nicht, dessen aphoristisches Schreiben für Deleuze einmal "die reine Materie des Lachens und der Lust" war (Deleuze, Gilles: Nietzsche. Ein Lesebuch. Berlin 1979. S.118), denn sein Aufbrechen "der linearen Einheit des Wissens" wird in der "zyklischen Einheit der ewigen Wiederkehr wieder aufgehoben, ähnlich wie bei Joyce, der die lineare Einheit der Wörter und der Sprache aufbricht, um im gleichen Zuge eine zyklische Einheit des Satzes, des Textes oder des Wissens herzustellen" (10).
[12] Welsch, Wolfgang: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Frankfurt 1996. S. 360.
Welsch, der bislang als Verfechter des Denkens Lyotards sich einen Namen gemacht hat, scheint mit seinem großangelegten (Typ Lebenswerk) Buch einen deleuzeianischen Sprung zu vollführen, und das ist auch notwendig, wenn er seinen Gedanken der Transversalität der Vernunft behaupten will; nur wird man das Gefühl nicht los, dass besagtes Konzept, den erhofften Schritt in die Originalität nicht garantiert, denn es sind vor allem die Gedanken Deleuzens, die, in anderes Vokabular gekleidet, immer wieder daraus hervorlugen. So gelingt es dem Bamberger Philosophen nicht recht, Defizite im Rhizomkonzept aufzuspüren, die dann sein Transversalitätskonzept beseitigen könnte. Der dort erhobene implizite Totalitaritätsvorwurf, wonach Deleuze/Guattari die Wurzel und die Büschelwurzel zugunsten des absolut gesetzten Rhizoms eliminierten, verpufft deswegen als Kritik, weil er einfach nicht stimmt. Natürlich bleiben - und das ist die einzig mögliche Konsequenz der Prinzipien von Heterogenität und Konnexion - die anderen Formen als Möglichkeiten bestehen. "Es gibt also", schreiben Deleuze und Guattari, "die verschiedensten Verkettungen von Karten und Kopien, von Rhizomen und Wurzeln, mit variablen Deterritorialisierungskoeffizienten. Es gibt Baum- und Wurzelstrukturen in den Rhizomen, aber Zweige und Wurzelteile können auch plötzlich rhizomartig Knospen treiben. Die Bestimmung hängt hier nicht von theoretischen Analysen ab, die Universalien implizieren, sondern von einer Pragmatik, die Vielheiten oder Ensembles von Intensitäten zusammensetzt. Im Innern eines Baumes, in der Höhlung einer Wurzel oder in der Gabelung eines Zweiges kann ein neues Rhizom entstehen. Oder besser: ein mikroskopisches Element des Wurzelbaumes oder eine Wurzelfaser setzt die Produktion des Rhizoms in Gang." ( 25) und: "Aber natürlich ist uns auch eine Sackgasse recht, denn sie kann ja auch zum Rhizom gehören" (Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Berlin 1976. S. 8)
[13] Breuer, Ingeborg/Leusch, Peter/Mersch, Dieter: Welten im Kopf. Profile der Gegenwartsphilosophie Frankreich/Italien. Hamburg 1996. S. 61
[14] Kuhn, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolution. Frankfurt 1989
[15] Baudrillard, Jean: Oublier Foucault. München 1983
[16] ebd. S. 42
[17] ebd. S. 41
[18] ebd. S. 43
[19] "Auch ein 'offener' Text ist doch immer ein Text, und ein Text kann zwar unendlich viele Interpretationen anregen, erlaubt aber nicht jede beliebige Interpretation. Man kann nicht sagen, welches die beste Interpretation eines Textes ist, doch kann man durchaus sagen, welche Interpretationen falsch sind. Im Verlauf der unbegrenzten Semiose kann man von jedem Knoten des Netzwerkes zu jedem anderen gehen; aber dabei sind Regeln der Zusammenhangssetzung zu beachten, die die Geschichte unserer Kultur in gewisser Weise legitimiert hat" (Eco, Umberto: Die Grenzen der Interpretation. München/Wien 1992. S. 144
[20] Deleuze, Gilles: Bartleby oder die Formel. Berlin 1994. S. 39
[21] Erdmann, Eva: Monsieur Rhizome. Paul Valéry und seine Cahiers. in: Balke/Vogl, S.304-318. S. 311
[22] "...schließlich gibt es das rhizomorphe Buch und Gebilde (livre rizomorphe), das sowohl die Bestimmung des äußeren Bezugs als auch des inhärenten Beziehungsgefüges seiner Teile aufgibt. Das Rhizom hört nicht auf zu produzieren, neue Satz- und Wortreihen zu bilden, neue Bilder herzustellen und sie in neue Zusammenhänge zu stellen. Offensichtlich hat das Rhizom weder einen Anfang noch ein Ende, es besteht aus begehbaren Räumen, die auf verschiedenen Etagen ineinander übergehen und verschieden genutzt werden können. Das rhizomorphe Werk verzichtet auf ein literarisches Gewand und wirft seine Äußerungen in der Form aus, in der sie zu Tage treten, als Seufzer, unartikulierte Gedankenströme, manierierte Satzverdrehungen und 'Stottern der Sprache selbst'. Zugunsten heterogener Sprechweisen werden die Despoten der 'Großsprache' übergangen, um die Äußerungen hervorzuheben, wie sie ihre Existenz jenseits der Literatur fristen" (Erdmann 311). Was die "Despoten der Großsprache betrifft, so verweist Eva Erdmann auf eine Passage der "Dialoge", wo Marx, Freud und Saussure als "Konzern, (der) eine herrschende Großsprache" (Dialoge 21) bilde, genannt werden.
[23] Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Berlin 1976. 84)
[24] Röttgers, Kurt/Gehring, Petra: Französische Philosophie der Gegenwart II. Lacan-Foucault- Deleuze/Guattari Hagen 1993. S. 195f.
Dies verallgemeinernd lässt die Signatur der Postmoderne durchscheinen: "'Postmodern ist, wer sich jenseits von Einheitsobsessionen der irreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk-, und Lebensformen bewusst ist und damit umzugehen weiß. Und dazu muss man keineswegs im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert leben, sondern kann schon Wittgenstein oder Kant, kann Diderot, Pascal oder Aristoteles geheißen haben" (Welsch: Postmoderne 35).
© Dieser Text ist geistiges Eigentum von Jörg Seidel und darf ohne seine schriftliche Zustimmung in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor. Letzte Änderung dieser Seite: 21.09.2004
Weitere Texte von Jörg Seidel (vornehmlich zum Thema "Schach") finden Sie unter http://www.koenig-plauen.de/Metachess
'What can a body do?', of what affects is it capable? [...] Spinoza never ceases to be amazed by the body. He is not amazed at having a body, but by what the body can do. Bodies are not defined by their genus or species, by their organs and functions, but by what they can do, by the affects of which they are capable (Deleuze and Parnet, 1987: 60).
Maandag 27 augustus 2007 - Lyotard (2) over 'La condition postmoderne'
 Jean-François Lyotard: Introduction to The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
Jean-François Lyotard: Introduction to The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
(een bespreking van het boek door Lyotard zelf
Een mooie zin uit de bespreking:
'The author of the report is a philosopher, not an expert. The latter knows what he knows and what he does not know: the former does not.').
The object of this study is the condition of knowledge in the most highly developed societies. I have decided to use the word postmodern to describe that condition. The word is in current use on the American continent among sociologists and critics; it designates the state of our culture following the transformations which, since the end of the nineteenth century, have altered the game rules for science, literature, and the arts. The present study will place these transformations in the context of the crisis of narratives.
Science has always been in conflict with narratives. Judged by the yardstick of science, the majority of them prove to be fables. But to the extent that science does not restrict itself to stating useful regularities and seeks the truth, it is obliged to legitimate the rules of its own game. It then produces a discourse of legitimation with respect to its own status, a discourse called philosophy. I will use the term modern to designate any science that legitimates itself with reference to a metadiscourse of this kind making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of Spirit, the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth. For example, the rule of consensus between the sender and addressee of a statement with truth-value is deemed acceptable if it is cast in terms of a possible unanimity between rational minds: this is the Enlightenment narrative, in which the hero of knowledge works toward a good ethico-political end - universal peace. As can be seen from this example, if a metanarrative implying a philosophy of history is used to legitimate knowledge, questions are raised concerning the validity of the institutions governing the social bond: these must be legitimated as well. Thus justice is consigned to the grand narrative in the same way as truth.
Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward metanarratives. This incredulity is undoubtedly a product of progress in the sciences: but that progress in turn presupposes it. To the obsolescence of the metanarrative apparatus of legitimation corresponds, most notably, the crisis of metaphysical philosophy and of the university institution which in the past relied on it. The narrative function is losing its functors, its great hero, its great dangers, its great voyages, its great goal. It is being dispersed in clouds of narrative language elements - narrative, but also denotative, prescriptive, descriptive, and so on. Conveyed within each cloud are pragmatic valencies specific to its kind. Each of us lives at the inter section of many of these. However, we do not necessarily establish stable language combinations, and the properties of the ones we do establish are not necessarily communicable.
Thus the society of the future falls less within the province of a Newtonian anthropology (such as structuralism or systems theory) than a pragmatics of language particles. There are many different language games a heterogeneity of elements. They only give rise to institutions in patches-local determinism.
The decision makers, however, attempt to manage these clouds of sociality according to input/output matrices, following a logic which implies that their elements are commensurable and that the whole is determinable. They allocate our lives for the growth of power. In matters of social justice and of scientific truth alike, the legitimation of that power is based on its optimizing the system's performance - efficiency. The application of this criterion to all of our games necessarily entails a certain level of terror, whether soft or hard: be operational (that is, commensurable) or disappear.
The logic of maximum performance is no doubt inconsistent in many ways, particularly with respect to contradiction in the socioeconomic field: it demands both less work (to lower production costs) and more (to lessen the social burden of the idle population). But our incredulity is now such that we no longer expect salvation to rise from these inconsistencies, as did Marx.
Still, the postmodern condition is as much a stranger to disenchantment as it is to the blind positivist of delegitimation. Where, after the metanarratives, can legitimacy reside? The operativity criterion is technological; it has no relevance for judging what is true or just. Is legitimacy to be found in consensus obtained through discussion, as Jurgen Habermas thinks? Such consensus does violence to the heterogeneity of language games. And invention is always born of dissension. Postmodern knowledge is not simply a tool of the authorities; it refines our sensitivity to differences and reinforces our ability to tolerate the incommensurable. Its principle is not the expert's homology, but the inventor's paralogy.
Here is the question: is a legitimation of the social bond, a just society, feasible in terms of a paradox analogous to that of scientific activity? What would such a paradox be?
The text that follows is an occasional one. It is a report on knowledge in the most highly developed societies and was presented to the Conseil des Universities of the government of Quebec at the request of its president. I would like to thank him for his kindness in allowing its publication.
It remains to be raid that the author of the report is a philosopher, not an expert. The latter knows what he knows and what he does not know: the former does not. One concludes, the other questions - two very different language games. I combine them here with the result that neither quite succeeds.
The philosopher at least can console himself with the thought that the formal and pragmatic analysis of certain philosophical and ethico-political discourses of legitimation, which underlies the report, will subsequently see the light of day. The report will have served to introduce that analysis from a somewhat sociologizing slant, one that truncates but at the same time situates it.
Such as it is, I dedicate this report to the Institut Polytechnique de Philosophie of the Universite de Paris VIII (Vincennes) - at this very postmodern moment that finds the University nearing what may be its end, while the Institute may just be beginning.
Zondag 26 augustus 2007 – Lyotard: niet ‘worden’, maar ‘zijn’
 Te vaak vergeet ik te denken aan de franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) en dan vooral aan ‘La condition postmoderne’ (1979). Geen ‘groot verhaal’ komt je ooit te hulp, je kunt alleen maar zijn die je wordt. Te vaak ben ik ten prooi gevallen aan de illusie van het meta-discours, het alomvattende verhaal, waarin alle dingen een plek krijgen. Er bestaat geen één zingevend verhaal, er zijn alleen onze individuele verhalen, ‘petit récits’ noemt Lyotard dat. Met moeite realiseer ik me in momenten van helderheid dat de mens niet wordt die zij/hij ‘moet zijn’, maar is degene die zij/hij ‘wordt’. (Let op: hier ligt een directe link met de freudiaanse gedachte van Über-Ich [worden die je ‘moet’ zijn] en Ich [wees wie je nú wórdt]!) Je hebt ten diepste de keuze tussen ‘de lach en de vergetelheid’ (Milan Kundera heeft deze Lyotard-one-liner tot boektitel gemaakt). Lyotard voert me dan weer terug tot de taalspelen van Wittgenstein II, het ‘anything goes’ van Paul Feyerabend en anderen.
Te vaak vergeet ik te denken aan de franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) en dan vooral aan ‘La condition postmoderne’ (1979). Geen ‘groot verhaal’ komt je ooit te hulp, je kunt alleen maar zijn die je wordt. Te vaak ben ik ten prooi gevallen aan de illusie van het meta-discours, het alomvattende verhaal, waarin alle dingen een plek krijgen. Er bestaat geen één zingevend verhaal, er zijn alleen onze individuele verhalen, ‘petit récits’ noemt Lyotard dat. Met moeite realiseer ik me in momenten van helderheid dat de mens niet wordt die zij/hij ‘moet zijn’, maar is degene die zij/hij ‘wordt’. (Let op: hier ligt een directe link met de freudiaanse gedachte van Über-Ich [worden die je ‘moet’ zijn] en Ich [wees wie je nú wórdt]!) Je hebt ten diepste de keuze tussen ‘de lach en de vergetelheid’ (Milan Kundera heeft deze Lyotard-one-liner tot boektitel gemaakt). Lyotard voert me dan weer terug tot de taalspelen van Wittgenstein II, het ‘anything goes’ van Paul Feyerabend en anderen.
Verderop in deze bijdrage een gesprek met Lyotard uit Filosofie Magazine, die toen al ernstig aan leukemie leed. Een citaat uit dit interview: La condition postinoderne beschrijft ook een 'postmoderne' mens - zonder vertrouwen in grote verhalen: 'Er is (...) niet werkelijk sprake van een levensdoel. Dat wordt aan ieders initiatief overgelaten. leder wordt naar zichzelf terugverwezen. En ieder weet dat dit zelf weinig om het lijf heeft.' Het zelf heeft weinig om het lijf omdat de menselijke geest een raadselachtig, niet rationeel te vatten labyrint is. Wie er diep in doordringt, schreef Lyotard in ‘Économie libidinale’, merkt dat het wezen van de mens leeg is. Er staat niets of niemand aan het stuur van de geest. Ons diepste wezen is een gapend gat waar woorden en driften in steeds nieuwe constellaties omheen circuleren.
Tot zover het citaat.
De crisis in de wetenschap, op gang gebracht door de ontdekking van de niet-euclidische meetkunden (1829-1871), versterkt door de komst van de quantummechanica (1900), door de ontdekking van de speciale (1905) en de algemene relativiteitstheorie (1916), door de vaststelling van het duaal karakter van het licht (1905, 1922), door de introductie van de schrödingervergelijkingen (1926), door de ineenstorting van het atoommodel van Niels Bohr met Heisenbergs “uncertainty principle” (1927), door de formulering van Kurt Gödels onzekerheidsstelling (1931), door de manier waarop Wittgenstein II de betekenistheorie uit de Tractatus op een hoopje veegde (1933-1935), door de onmogelijkheid van de logisch-positivisten om open generaliserende proposities in logisch atomaire zin af te sluiten (1929-1940), door de illusie van een popperiaans asymmetriebeginsel van de waarheid (1935-1970), ressorterend in het methodologisch anarchisme van Paul Feyerabend (1970) — dat alles zadelde de westerse samenleving op met het postmoderne gevoel dat de waarheid niet bestaat, dat de waarheid een “simulacre” is (Deleuze). Lyotard gaat zelfs zover uit te roepen dat de waarheid niet enkel niet bestaat, maar dat we moeten ophouden een betekenis aan “waarheid” te geven.
De Tractatus (1921) die toch de mogelijkheid had gesuggereerd wetenschappelijk ware uitspraken te kunnen onderscheiden van metafysische die noch waar noch onwaar waren — dat monument van menselijk denken werd in drie fasen gesloopt. Karl R. Popper stelde vast dat open generalisaties niet afdoend konden worden geverifieerd (1935), Karl-Otto Apel stelde vast dat Wittgensteins extentionaliteitsbeginsel van de waarheid niet opging voor “belief sentences” (1955), en Jacques Derrida ondermijnde met zijn logocentrisme de afbeeldingstheorie van de taal die aan de Tractatus ten grondslag lag (1972). 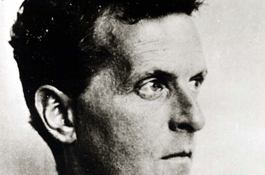 Uiteindelijk was Wittgenstein II ze alle drie te vlug af geweest en gooide hij met zijn theorie van de taalspelen een glazen man — Wittgenstein I — aan scherven. In die zin begint het postmoderne denken bij de Wittgenstein van The Blue and Brown Books (1933-1935) en bereikt het een voorlopig hoogtepunt in Lyotards ‘La Condition postmoderne’ (1979) waarin hij, vertrekkend van Wittgensteins taalspelen, de unitaire metataal ter beschrijving van de geschiedenis verwerpt, de “meta-récit” naar de uitgang stuurt en de “petits récits” als beschrijving van de versplinterde werkelijkheid tot postmodern canon verheft. In Mille tableaux (1980) van Gilles Deleuze en Félix Guattari luidt het dat uniciteit en centrum van de waarheid overblijfselen zijn van een totalitair denken dat plaats moet ruimen voor de nieuwe rhyzomologie.
Uiteindelijk was Wittgenstein II ze alle drie te vlug af geweest en gooide hij met zijn theorie van de taalspelen een glazen man — Wittgenstein I — aan scherven. In die zin begint het postmoderne denken bij de Wittgenstein van The Blue and Brown Books (1933-1935) en bereikt het een voorlopig hoogtepunt in Lyotards ‘La Condition postmoderne’ (1979) waarin hij, vertrekkend van Wittgensteins taalspelen, de unitaire metataal ter beschrijving van de geschiedenis verwerpt, de “meta-récit” naar de uitgang stuurt en de “petits récits” als beschrijving van de versplinterde werkelijkheid tot postmodern canon verheft. In Mille tableaux (1980) van Gilles Deleuze en Félix Guattari luidt het dat uniciteit en centrum van de waarheid overblijfselen zijn van een totalitair denken dat plaats moet ruimen voor de nieuwe rhyzomologie.
'La condition postmoderne: rapport sur le savoir' (1979) is een kort maar invloedrijk boek van de Franse filosoof Jean-François Lyotard, waarin deze de epistemologie van de postmoderne cultuur analyseert als het einde van de grote verhalen (grand récits of metanarratifs): overkoepelende filosofische theorieën van wetenschap en geschiedenis die als hij kenmerkend beschouwt voor de moderniteit. Het werk introduceerde de term 'postmodernisme', die eerder in de kunstkritiek gebruikt werd, in de filosofie.
Tot de metanarratifs behoren het reductionisme in de wetenschapsfilosofie en de teleologische opvattingen van de menselijke geschiedenis zoals die van de Verlichting en het marxisme. Deze zijn onhoudbaar geworden, meent Lyotard, door de technologische vooruitgang op de gebieden van communicatie, massamedia en informatica. Technieken als kunstmatige intelligentie en machinaal vertalen, die eind jaren '70 een grote vlucht namen, duiden op een verschuiving naar talige en symbolische productie als centraal element in de postindustriële economie en de daarmee samenhangende postmoderne cultuur, die eind jaren '50 was begonnen na de wederopbouw van West-Europa. Het gevolg hiervan is een veelheid aan 'taalspelen' (een term ontleend aan Wittgenstein) zonder overkoepelende structuur, waarmee de moderne wetenschap haar eigen metanarratif ondergraaft.
Het boek pleit voor een diversiteit aan kleine verhalen die met elkaar kunnen concurreren, ter vervanging van de totalitaire grote verhalen. Hierdoor is het vaak gelezen als een pleidooi voor ongebreideld relativisme, dat voor velen ook als wezenskenmerk van de postmoderne filosofie is gaan gelden.
La condition postmoderne werd geschreven als rapport over de invloed van technologie op de epistemologie van de exacte wetenschappen, in opdracht van de regering van Québec. Hiermee is het een 'vreemde eend' in het oeuvre van Lyotard, omdat hij (zoals hij zelf later toegaf) een 'minder dan beperkte' kennis van de exacte vakken bezat. Zijn gebruikelijke hoofdthema's, kunst en politiek, komen niet in het werk voor. Om zijn geringe kennis te compenseren, verzon Lyotard verhalen en verwees hij naar verscheidene boeken die hij nooit gelezen had. Achteraf noemde hij La condition 'een parodie' en 'simpelweg de slechtste van al mijn boeken'. Desondanks is het, zeer tot Lyotards spijt, zijn populairste werk geworden.
Uit Filosofie Magazine:
Het einde van de grote Jean-François Lyotard
Gesprek over de zin van het leven
Door: Erno Eskens
Op 22 april 1998 overleed Jean-François Lyotard in Parijs. Een klein jaar geleden - Lyotard was toen al ernstig ziek - zocht Filosofie Magazine hem op voor een gesprek over de zin van het leven en het belang van kunst. De slotwoorden van een van de grootste denkers van deze eeuw.
Ik ben geen filosoof. Niemand is filosoof. Je kunt hooguit zeggen: sommige mensen proberen te filosoferen. Ik denk dat ik er een van ben.' Het is voorjaar 1997, precies een jaar voordat de altijd rokende Jean-Francois Lyotard in Parijs overlijdt aan leukemie. De schrijver van La condition postmoderne en Le différend zit aan de werktafel in zijn zolderappartement in de Parijse binnenstad. Buiten schijnt de zon, binnen zit een vrolijke, af en toe grijs wegtrekkende man die steeds vermoeider oogt. 'Kunnen we nu stoppen? Een laatste vraag misschien?'
In Algerije, waar hij filosofiedocent was op het Lyceum van Constantine, streed hij met woord en daad tegen het Franse kolonialisme. Terug in Frankrijk richtte hij zijn pijlen op het kapitalisme. Hij roerde zich van 1954 tot 1964 in een marxistische groepering rondom het tijdschrift Socialisme ou barbarie. Maar terwijl zijn collega's als fellowtravellers naar Rusland trokken kwam Lyotard in 1966, twee jaar voor de linkse studentenrevoltes, met forse kritiek op de beweging voor de dag. De marxisten waren op sommige punten te stellig. Vooral hun volstrekt rationele kijk op de geschiedenis stuitte Lyotard tegen de borst.
In 1979 publiceerde Lyotard 'La condition postmoderne', een spraakmakend werk dat in het Nederlands is vertaald als Het postmoderne weten. Hoewel het als een tussendoortje was bedoeld, behoort het tot de invloedrijkste filosofieboeken van deze eeuw. Met enig gevoel voor profetie kondigt Lyotard 'het einde van de grote verhalen' aan. Hij kijkt verveeld als het boek ter sprake komt. 'Iedereen doet alsof dat boek mijn hoofdwerk is.' Het is met hem aan de haal gegaan. Maar in grote lijnen staat hij er nog steeds achter. 'Vorige generaties hadden grote verhalen over emancipatie, vrijheid, volledige kennis en beheersing door de technologie in hun achterhoofd. Ik constateerde in dat boek een groot wantrouwen ten opzichte van die verhalen. Termen als "de algehele koers en richting van de geschiedenis" stuiten mij tegen de borst.' Na deze bloedige eeuw kan niemand volhouden dat de geschiedenis ergens heengaat, dat er een continue vooruitgang in zit.
Hoewel hij het vooruitgangsgeloof definitief naar de prullenmand heeft verwezen, blijft Lyotard vasthouden aan de idealen van de Verlichting. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn voortaan geen verre einddoelen meer, je moet er hier en nu voor vechten. 'We moeten zoveel mogelijk ingrijpen in de geschiedenis. Om iets te redden van de idealen: rechtvaardigheid, rechtvaardigheid en uiteindelijk niets dan rechtvaardigheid. Als we merken dat er ergens mensen in het gedrang komen en gewond raken, moeten we in verzet komen.'
'La condition postinoderne' beschrijft ook een 'postmoderne' mens - zonder vertrouwen in grote verhalen: 'Er is (..) niet werkelijk sprake van een levensdoel. Dat wordt aan ieders initiatief overgelaten. leder wordt naar zichzelf terugverwezen. En ieder weet dat dit zelf weinig om het lijf heeft.' Het zelf heeft weinig om het lijf omdat de menselijke geest een raadselachtig, niet rationeel te vatten labyrint is. Wie er diep in doordringt, schreef Lyotard in Economie libidinale, merkt dat het wezen van de mens leeg is. Er staat niets of niemand aan het stuur van de geest. Ons diepste wezen is een gapend gat waar woorden en driften in steeds nieuwe constellaties omheen circuleren.
Stijl
Het 'grote verhaal' dat wij een substantieel wezen, een onvervreemdbaar ik of een denkcentrum hebben dat 'zichzelf kan worden, blijkt onhoudbaar. Er is niets natuurlijks, niets vanzelfsprekends in de schijnbaar vanzelfsprekende loop van het leven. Ook in de privé-geschiedenis moeten we daarom zoveel mogelijk ingrijpen: 'Om iets te redden van de idealen.'
Af en toe moet je daarom de roest van je bestaan schuren, meent Lyotard: 'Maar dat is helemaal niet eenvoudig. Je kunt niet zomaar even een andere interpretatie van je bestaan omarmen. En er is bovendien ook helemaal geen reservoir aan zinvolle betekenissen voorhanden waar je makkelijk uit kunt putten. Je kunt hooguit openstaan voor betekenissen en mogelijkheden die zich aandienen. Dat is de kunst, om een soort nieuwsgierigheid te behouden naar de mogelijke invulling van de zin van het leven; om het antwoord steeds open te houden. Om je niet vast te leggen.'
'Iedereen geeft het leven op zijn of haar eigen wijze vorm. Iedereen heeft wat dat betreft een stijl. Die stijl merk je als mensen iets maken: als ze zinnen vormen, producten maken, handelen. Iedereen doet dat, maar bijna niemand beseft het. Kunstenaars zijn wat dit betreft een uitzondering. Die doen het wel bewust. Ze ontwrichten doelbewust de bestaande stramienen om nieuwe betekenissen mogelijk te maken.'
'Ik ben zelf eerst in de literatuur actief geweest. Schrijven is een vorm van verzet tegen de schijnbaar vanzelfsprekende gang van zaken. Ik schreef wat wij in Frankrijk een nouveau roman noemen. Maar het was in mijn ogen niet goed genoeg, dus ik heb het niet uitgegeven. Het ligt nog ergens. Vervolgens heb ik mijn plannen bijgesteld en ben ik gaan filosoferen. Je moet er harder bij nadenken, maar je bent bevrijd van het literaire keurslijf. Tijdens het filosoferen ontdekte ik dat de taal ontzettend veel mogelijkheden biedt. Daar wijs ik op. In die zin is filosoferen ook een verzetsdaad.'
In 1985 organiseerde Lyotard een grote tentoonstelling, Les Immateriaux, in Parijs. Met die tentoonstelling wilde hij duidelijk maken dat immateriële ideeën vaak veel reëler zijn dan fysiek aanwijsbare dingen. Parijs stond op zijn kop en het was dringen bij de ingang. Hij moet er nog om lachen als hij eraan denkt. 'Als je een tentoonstelling bedenkt, ben je plotseling iemand. Dan komen ze je met de limo ophalen. Als eenvoudig filosoof zal je zoiets niet snel meemaken.'
Vooral het werk van de kunstenaars Adami, Arakawa en Buren boeit hem. Hij schreef er het rijk geïllustreerde Que peindre? over. 'Wat gebeurt er als je naar een schilderij kijkt?', vraagt hij, terwijl hij een blik werpt op een schilderij van Valerio Adami dat in zijn woonkamer hangt. 'De Grieken en Romeinen dachten dat je dan een gevoel van schoonheid hebt. En ze dachten dat het schone ook altijd goed was. Dat vinden we nu niet meer. Het bekijken van zo'n schilderij is niet alleen maar prettig. Sommige kunstwerken wekken tegenstrijdige gevoelens op: pijn en plezier, vreugde en angst. Als dat gebeurt, heb je te maken met "sublieme kunst". Die term komt uit de vierde eeuw, was eeuwenlang in onbruik, en dook in het werk van Immanuel Kant opnieuw op. Bij het sublieme komt er iets anders dan dat aangename gevoel van schoonheid om de hoek kijken. Je wordt geconfronteerd met iets wat je niet kunt plaatsen; een ambigue ervaring, controversieel in de zin dat het je tegelijkertijd afstoot en aantrekt.'
Filosofische dood
'Vroeger hadden we dat soort ervaringen alleen bij het zien van overweldigende zaken. Een kathedraal bijvoorbeeld, zo'n groots ding dat een gevoel van extase en verheffing oproept en dat met zijn kerktoren naar de hemel wijst. Er is daarbij sprake van een soort angst voor de dood. En dan heb ik het natuurlijk over de dood in de filosofische zin van het woord. je mond valt open, je staat perplex, relaties met de ander vallen even weg, er is die plotselinge afwezigheid van taal, van visie, van gehoor, van zin, et cetera.'
'Samuel Beckett heeft dat idee van het sublieme naar het dagelijks leven verplaatst. Als Beckett over iets simpels als "lopen" schrijft, dan wordt dat subliem. Zoiets heel vanzelfsprekends blijkt plotseling volstrekt wonderbaarlijk. Iedere stap vereist een ongelooflijke samenwerking van spieren, gewrichten, natuurkrachten - hoe de ene voet voor de andere komt.'
In het sublieme moment wordt het bestaan even ontdaan van vaste betekenissen, waardoor het mogelijk wordt om het van andere zin te voorzien. Ook de 'verzetswerken' van de Franse kunstenaar Daniel Buren verbreken op die manier de overheersing van het vastgeroeste verstand. Ze wijzen volgens Lyotard op alternatieve manieren om zin te geven aan het leven. 'Neem dat werk 'Les deux plateaux' op de binnenplaats van het Cour d'honneur van het Palais Royal. Het bestaat uit een aantal zuilen van verschillende hoogtes. En het is subtiel geïntegreerd in de omgeving. Een serie zuilen midden in de binnentuin van een paleis. Parijzenaars vinden het een heel gewoon kunstwerk; ze zitten erop, ze spreken af bij de zuilen. Maar tegelijkertijd vervreemdt het, omdat die zuilen er volgens een patroon zijn neergezet. Dan herken je het: het is net de ruïne van een paleis. Het is de afwezigheid en het verval van een paleis, in een nog bestaand paleis. Dat is unheimisch, vreemd en verontrustend. Het grijpt je bij de strot; je ervaart het, er gebeurt iets, en moet het interpreteren. En dat maakt het zo bijzonder: dat het bestaan ons zo'n nieuwe kans geeft tot nadenken.' 'Als men denkt', schrijft Lyotard in L'inhumain uit 1988, 'accepteert men het voorval voor wat het is: "nog niet bepaald". Er wordt geen vooroordeel over geveld en er wordt geen zekerheid aan ontleend.' Die zekerheid hebben we niet nodig. je kunt prima leven in onzekerheid, dat biedt je de ruimte om je eigen bestaan in te vullen: 'De zin van het leven? Hmm. Als slotvraag? Hmm. Je moet die vraag niet beantwoorden, denk ik. Je kunt dit beter openhouden, tot het eind. Op deze vraag is geen definitief antwoord mogelijk. Daarmee wil ik niet zeggen dat het leven zinloos is. Je moet er alleen steeds opnieuw een draai aan geven. Steeds opnieuw.' Lachend: 'De zin van het leven is het creëren van de zin van het leven, is het creëren van de zin van het leven, is het creëren van de zin van het leven.'
Lyotard overleed 22 april 1998 in Parijs. Hij werd 73 jaar.
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Teleac/NOT.
Veel van Lyotards werken verschenen in vertaling bij uitgeverij Kok Agora. Frans van Peperstraten publiceerde bij dezelfde uitgeverij Jean-François Lyotard; gebeurtenis en rechtvaardigheid, een goed overzichtswerk over de Franse filosoof (160 blz., f 29,90)
1924: Geboren in Versailles. Als jongeling neemt Lyotard de benen uit een seminarie. 'Ik heb altijd monnik willen worden, maar ik hield te veel van vrouwen. Dus bleef alleen de filosofie over.'
1944: Als vrijwilliger bij de eerste-hulp helpt Lyotard Parijs bevrijden uit Duitse handen. Hij gaat filosofie studeren en specialiseert zich in het werk van de Franse psycholoog Pierre Janet.
1950: Verhuizing naar Algerije. 'Ik wilde weg uit het Quartier Latin', vertelt Lyotard in 1993 in Filosofie Magazine. 'Dat was te beklemmend. En ik was gefascineerd door een andere cultuur.' Hij wordt filosofiedocent op het Lycée in Constantine.
1952: Terug in Frankrijk verzet Lyotard zich tegen de repressie van de Franse regering ten opzichte van de Algerijnse vrijheidsstrijders.
1954: Lyotard promoveert bij Paul Ricoeur en treedt toe tot Socialisme ou Barbarie, een links-radicale groepering. 'Ik geloofde niet dat deze beweging in een werkelijke revolutie zou resulteren, maar ik nam gewoon mijn verantwoordelijkheid; om te laten zien dat er iets niet in orde was.'
1968: Tijdens de studentenopstand gedraagt Lyotard, inmiddels hoogleraar aan de universiteit van Nanterre, zich als een militant, 'terwijl ik er diep in mijn hart niet in geloofde'.
1971: De verschijning van Discours, figure markeert Lyotards toenemende interesse voor taalfilosofie en voor Freud: 'Het verlangen spreekt niet, maar doet de orde van het spreken geweld aan.'
1974: In een crisistoestand schrijft Lyotard Economie libidinale, naar eigen zeggen 'een verschrikkelijk boek, geschreven met een soort gemeen genoegen, volledig destructief.'
1979: Op aandringen van een Canadees instituut schrijft Lyotard La condition postmoderne; rapport sur Ie savoir, vertaald als Het postmodeme weten. Conclusie: 'De consensus is een verouderde, en verdachte, waarde geworden. Rechtvaardigheid is dat niet. We moeten dus tot een idee en een praktijk van rechtvaardigheid komen die niet verbonden is met die van de consensus. (..) Een politiek tekent zich af waarin het verlangen naar rechtvaardigheid en naar het onbekende gelijkelijk gerespecteerd zullen worden.'
1983: Le différend is Lyotards hoofdwerk: een politiek-filosofisch vervolg op de taalfilosofie van Wittgenstein.
1985: In Parijs organiseert Lyotard een grote kunsttentoonstelling, Les Immateriaux. Bezoekers worden geconfronteerd met kunstmatige geuren die echter ruiken dan de echte geuren. 'Men verwijt mij dat ik me terugtrek in de kunst, maar ik zou niet weten wat ik over politiek moet zeggen. Niets anders dan wat eik redelijk mens daarover te zeggen heeft: dat je geen oorlog moet voeren, moet proberen iedereen werk te geven en dus de werktijd over de gehele wereld moet verminderen.'
1986: Met L'enthousiasme; la critique kantienne de I'histoire herontdekt Lyotard de metafoor van Kant dat taal een eilandenrijk is. 'Genres van discours zijn te vergelijken met eilanden in een archipel. Ik kan je aanspreken met een gedicht, een wetenschappelijke verhandeling, of bijvoorbeeld een gebed. En het is onmogelijk om de betekenis uit het ene genre naar het andere te vertalen.'
1988: L'inhumain beschrijft het computer- en informatietijdperk. In Le Monde vat Lyotard het samen: 'Het staat vast dat de wetenschappelijke kennis in een proces van toenemende complexiteit is verwikkeld.'
1993: In Moralités postmodernes (Postmoderne fabels) staat Lyotard opnieuw stil bij 'het systeem': 'Gezondheid is het zwijgen van de organen, zei René Leriche, de chirurg van het lijden. Het systeem brengt het lawaai tot zwijgen; in eik geval waakt het erover.'
1998: Op 22 april sterft Lyotard. Op begraafplaats Père Lachaise in Parijs houdt premier Jospin een grafrede. Een boek over André Malraux is net verschenen, een boek over Augustinus blijft onaf op de schrijftafel liggen.